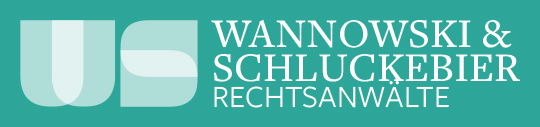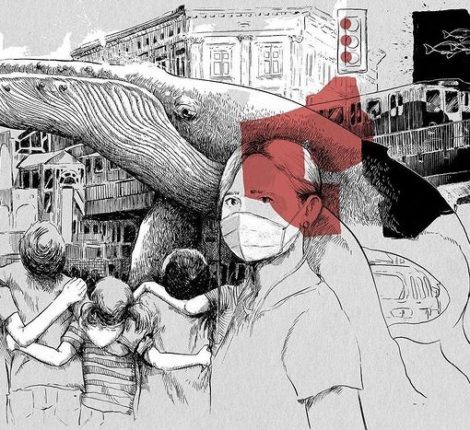Drohen rechtliche Nachteile, wenn man keinen Fahrradhelm trägt?
Gemäß einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR) tragen junge Fahrradfahrer selten einen Fahrradhelm, obwohl sie sich der Gefahren eines Fahrradunfalls ohne Fahrradhelm durchaus bewusst sind.
Hierzu äußerte sich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer wie folgt: „Mehr als die Hälfte der jungen Radfahrerinnen und Radfahrer sagen von sich selbst, dass sie nie oder nur selten einen Helm tragen. Und warum nicht? Weil es angeblich nicht cool aussieht. Mit unserer neuen Aktion „Looks like shit. But saves my life.“ richten wir uns daher gezielt an junge Menschen, um sie dazu zu motivieren, zum eigenen Schutz einen Helm aufzusetzen. Der Spruch entspricht vielleicht nicht so ganz dem üblichen Behördendeutsch. Er bringt die Botschaft aber ziemlich genau auf den Punkt: Helme retten Leben!“
Der Präsident des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR) Prof. Dr. Walter Eichendorf sagte hierzu: „Sicherlich kann diese Kooperation dazu beitragen, dass Fahrradhelme – ähnlich wie Skihelme – ein besseres Image bei jungen Menschen bekommen. Solche Maßnahmen für eine bessere Akzeptanz sind notwendig, denn Fahrradhelme können die meisten lebensbedrohlichen Kopfverletzungen verhindern. Es gibt nichts Wichtigeres, als die Gesundheit und das eigene Leben zu schützen“, sagt DVR-Präsident.
Viele Medien haben von der Kampagne berichtet, so dass diese zumindest eines ihrer Ziele, Aufmerksamkeit zu erzielen erreicht hat.
Im folgenden gehe ich kurz darauf ein, ob einem auch rechtliche Nachteile drohen, wenn man keinen Fahrradhelm benutzt.
Zunächst ist festzuhalten, dass es in Deutschland keine (gesetzliche) Pflicht gibt, einen Fahrradhelm zu nutzen. Somit drohen derzeit also keine unmittelbaren Sanktionen, wenn man keinen Fahrradhelm trägt.
Umstritten war, ob man sich bei einem von einem anderen verursachten Unfall ein Mitverschulden i.S.d. § 254 BGB anrechnen lassen muss, wenn man sich nicht selbst durch einen Fahrradhelm schützt. Folge dessen wäre, dass man nur einen um den eigenen Verschuldensanteil zu kürzenden Schadensersatz erhalten würde. Wie bei nahezu allen juristischen Fragestellungen kommt es hierbei auf den konkreten Einzelfall an, so dass sich eine pauschale Antwort verbietet. Die Rechtsprechung hat gewisse Kriterien hierzu aufgestellt.
Das Landgerichts Saarbrücken (Urteil vom 17. Januar 2007 – Az.: 3 O 397/05) und das Oberlandesgericht Saarbrücken (Urteil vom 09. Oktober 2008 – Az.: 4 U 80/07) haben im Ergebnis festgehalten, dass das fehlende Tragen eines Fahrradhelms erst dann einen Mitverschuldensvorwurf i.S.d. § 254 BGB begründen würde, wenn sich der Radfahrer als sportlich ambitionierter Fahrer besonderen Risiken aussetzt oder wenn in seiner persönlichen Disposition ein gesteigertes Gefährdungspotenzial bestehen würde. Dies war in dem konkreten Fall jedoch nicht so. Folglich hatten die Beklagte Fahrerin und Halterin sowie die Beklagte Versicherung, bei der das Fahrzeug haftpflichtversichert war, aufgrund eines Verkehrsunfall, der sich am 19. Mai 2005 ereignet hat, der Klägerin die ihr aufgrund des Unfalls entstandenen materiellen und immateriellen Schäden zu ersetzen.
Die Gerichte hielten fest, dass die Beklagten der Klägerin gem. § 7 Abs. 1, § 11 StVG, § 3 Nr. 1 PflVG, § 253 Abs. 2, § 823 BGB zum Ersatz der materiellen und immateriellen Schäden verpflichtet waren.
Im Ergebnis stimmten die Gerichte darüber überein, dass der Fahrradfahrerin kein Mitverschulden anzulasten sei.
Hat bei der Schadensentstehung ein Verschulden des Geschädigten mitgewirkt, so hängt gemäß § 9 StVG, § 254 BGB die Verpflichtung zum Ersatz sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den Umständen, insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder dem anderen Teil verursacht worden ist.
Ein Mitverschulden wurde der der Fahrradfahrerin nicht angelastet. Dies insbesondere auch nicht, weil sie bei der zum Unfall führenden Fahrt keinen Helm trug.
Rechtsprechung und Literatur zeigten damals ein differenziertes Bild in Bezug auf diese Frage. Für die damals ältere Rechtsprechung kam ein Mitverschulden des ohne Helm fahrenden Radfahrers grundsätzlich nicht in Betracht. Die damals wohl überwiegende Meinung hat einen Mitverschuldensvorwurf jedenfalls für besonders gefährdete Radfahrer, insbesondere für Kinder und sportlich ambitioniert fahrende Rennradfahrer, vorgenommen. In einem Urteil hat das Oberlandesgericht Düsseldorf (Urteil vom 18. Juni 2007 – I 1 U 278/06) die Auffassung vertreten, dass Fahrradfahrern, die ihr Fahrrad als gewöhnliches Fortbewegungsmittel ohne sportliche Ambitionen nutzen, die fehlende Benutzung eines Helms nicht als anspruchsminderndes Mitverschulden anzurechnen sei.
Diese Differenzierung hat die Gerichte auch im konkreten Fall überzeugt. Gegen ein generelles Mitverschulden ungeschützter Fahrradfahrer spricht vor allem, dass es im Gegensatz zum Führen von Krafträdern (§ 21a Abs. 2 StVO) keine den allgemeinen Straßenverkehr betreffende Regelung zum Tragen eines Schutzhelmes gibt. Vielmehr ist das Tragen von Schutzhelmen im Geltungsbereich von Verbandsregeln nur bei Rennradveranstaltungen vorgeschrieben. Aber auch hierbei gibt es Ausnahmen, bei denen keine Helme getragen werden müssen.
Natürlich ist zu beachten, dass es für die Annahme eines Mitverschuldens grundsätzlich nicht erforderlich ist, dass gegen eine gesetzliche Norm verstoßen worden ist. Die Mitverschuldensanrechnung ist eine Ausprägung des in § 242 BGB festgelegten Grundsatzes von Treu und Glauben, sodass hierfür nicht eine rechtswidrige Verletzung einer gegenüber einem anderen oder gegenüber der Allgemeinheit bestehenden Rechtspflicht erforderlich ist, sondern es primär um einen Verstoß gegen Gebote der eigenen Interessenwahrnehmung, der Verletzung einer sich selbst gegenüber bestehenden Obliegenheit geht.
Außerdem ist zu beachten, dass auch nicht darauf abgestellt werden kann, dass die unterlassene Maßnahme geeignet gewesen wäre, den eingetretenen Schaden zu verringern oder gar zu vermeiden. Diese Betrachtungsweise würde dazu führen, maximale Sicherheitsforderungen einzufordern, so das Oberlandesgericht Saarbrücken zutreffend. Dieses Gebot ist mit den Maßstäben der praktischen Vernunft nicht zu erfüllen, so dass Oberlandgericht weiter.
Schließlich ergebe sich auch aus den detaillierten, zahlreichen und unterschiedlichen Gesetzen ein umfassendes Regelungswerk des Gesetzgebers im Straßenverkehrsrecht. Der Verkehrsteilnehmer – vorliegend die Fahrradfahrerin – muss sich darauf verlassen können, dass er sich bei Einhaltung der Normen nicht durch die Anrechnung eines Mitverschuldens einem Rechtswidrigkeitsvorwurf aussetzen müsse. Insbesondere weil dem Gesetzgeber die schadensvermeidende Wirkung von Schutzhelmen bewusst war, er deren verbindliche Benutzung jedoch ausschließlich für Krafträder vorgeschrieben hat, liegt es aus Sicht des betroffenen Verkehrs nahe, die ausnahmslose, allgemeine Benutzung von Fahrradhelmen selbst im wohlverstandenen Eigeninteresse nicht als gebotene Maßnahme anzusehen.
Aufgrund der zuvor zusammengefassten Erwägung des Oberlandesgerichts Saarbrücken, hielt dies fest, dass ein Mitverschulden erst dann zu berücksichtigen ist, wenn sich der Radfahrer als sportlich ambitionierter Fahrer besonderen Risiken aussetzt. Außerdem sei ein Radfahrer zur Vermeidung von Haftungsnachteilen zum Tragen eines Helms gehalten, wenn in der persönlichen Disposition ein gesteigertes Gefährdungspotential besteht, beispielsweise aufgrund von Unerfahrenheit im Umgang mit dem Rad und/oder den Gefahren des Straßenverkehrs. Dieses Ergebnis deckte sich auch mit der damaligen Verkehrsanschauung, wonach die mit dem Fahrradfahren im Allgemeinen verbundenen Gefahren auch ohne Tragen eines Helmes in einem für das praktische Leben brauchbaren Maße beherrschbar waren.
Im Ergebnis stellte das Oberlandesgericht Saarbrücken im damals zu beurteilenden Sachverhalt fest, dass keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich waren, dass die Fahrradfahrerin gesteigerte Risiken auf sich genommen hatte. Ein Mitverschulden wurde aufgrund der zuvor erörterten Erwägungen konsequenterweise abgelehnt.
In einem dem des zuvor dargestellten Fall des Oberlandesgerichts Saarbrücken vergleichbaren Fall hat das Oberlandesgericht Schleswig (Urteil vom 5. Juni 2013 – Az. 7 U 11/12) der Fahrradfahrerin allein deshalb ein Mitverschulden von 20 Prozent angelastet, weil sie keinen Helm getragen hat, obwohl die Autofahrerin zweifelsfrei den Unfall verschuldet hatte. In dem von dem Oberlandesgericht Schleswig entschiedenen Fall war die Fahrradfahrerin ohne Fahrradhelm an einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw vorbeigefahren. Die Fahrradfahrerin stürzte, weil die Autofahrerin die kurz vor ihrem Eintreffen die Fahrertür öffnete und die Fahrradfahrerin nicht mehr ausweichen konnte, sondern gegen die Fahrertür fuhr. Die Fahrradfahrerin zog sich hierbei schwere Schädel-Hirnverletzungen zu. Hätte sie einen Fahrradhelm getragen, wären die Verletzungen wohl weniger schlimm gewesen.
Das Landgericht Flensburg (Urteil vom 12. Januar 2012 – Az.: 4 O 265/11) hatte der Fahrradfahrerin zunächst ungekürzten Schadensersatz zugesprochen. Insbesondere träfe sie kein Mitverschulden, da es keine allgemeine Helmpflicht gibt und sie ihr Fahrrad als gewöhnliches Fortbewegungsmittel genutzt hat. Das Landgericht Flensburg ist somit der oben dargestellten Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Saarbrücken gefolgt.
Dies sah das das Oberlandesgericht Schleswig anders. Vielmehr sei ein Mitverschulden der Fahrradfahrerin dadurch begründet, dass sie keinen Helm getragen und damit Schutzmaßnahmen zu ihrer eigenen Sicherheit unterlassen habe. Wer am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen würden, müsse sich entsprechen schützen. Tue man dies nicht, beispielsweise durch tragen eines Fahrradhelms, müsse man auch den Vorwurf des Mitverschuldens gegen sich gelten lassen. Zu Begründung wurde im Wesentlichen darauf abgestellt, dass der Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung ein Mitverschulden des Geschädigten auch ohne das Bestehen gesetzlicher Vorschriften angenommen hat. Es müsse sich „verkehrsrichtig“ verhalten werden. Ob man sich „verkehrsrichtig“ verhalten würde, sei nicht ausschließlich durch die geschriebenen Regeln der Straßenverkehrsordnung zu bestimmen. Vielmehr sein hierfür vor allem ebenfalls die konkreten Umstände und Gefahren im Verkehr sowie das den Verkehrsteilnehmern zumutbare, um diese Gefahr möglichst gering zu halten, entscheidend.
Außerdem sei eine immer größere Verbreitung des Tragens eines Fahrradhelms im alltäglichen Straßenbild so deutlich wahrzunehmen, so dass es eine allgemeine Überzeugung geben würde, einen Fahrradhelm zu tragen.
Die Differenzierung zwischen den verschiedenen Arten von Radfahrern führe ferner zu Abgrenzungsschwierigkeiten. Aufgrund der technischen Entwicklung könne man mit modernen Fahrrädern hohe Geschwindigkeiten erreichen.
Als entscheidend stellte das Oberlandesgericht Schleswig jedoch darauf ab, dass Fahrradfahrer mittlerweile im Straßenverkehr einem gesteigerten Verletzungsrisiko unterlegen würde, wie der Fall zeigen würde. U.a. aufgrund der mittlerweile herrschenden Dichte des Straßenverkehrs, der drohenden Fallhöhe sowie fehlender Möglichkeiten, sich abzustützen, sein Fahrradfahrer besonders gefährdet (schwere) Kopfverletzungen zu erleiden. Gerade hiervor solle der Helm schützen.
Ferner sei es eine Tatsache, dass ein Fahrradhelm de facto schützt. Darüber hinaus sei die Anschaffung eines Schutzhelms auch wirtschaftlich zumutbar. Somit müsse nach dem damaligen Erkenntnisstand grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass ein ordentlicher und verständiger Mensch zur Vermeidung eigenen Schadens beim Radfahren einen Fahrradhelm trägt.
Der Fahrradfahrerin sei somit ein Mitverschulden an der Schadensentstehung anzulasten, weil sie durch das Fahren ohne Fahrradhelm nicht die gebotene Umsicht gewahrt habe und somit auch keine zumutbare Maßnahme vorgenommen habe.
Den Mitverschuldensanteil der Fahrradfahrerin bemaß der Senat mit 20 %. Hierbei hat es auf die Feststellungen des Sachverständigen abgestellt, wonach ein Fahrradhelm die Kopfverletzung wohl hätte verringern, aber nicht verhindern können. Außerdem würde das grob fahrlässige Verhalten der Autofahrerin den Mitverschuldensanteil der Fahrradfahrerin deutlich überwiegen.
Im Jahr 2014 hat der Bundesgerichtshof eine Grundsatzentscheidung (Urteil vom 17. Juni 2014 – Az. VI ZR 281/13) getroffen. Hiernach trifft Fahrradfahrer grundsätzlich kein Mitverschulden an den Folgen eines Unfalls, alleine weil kein Fahrradhelm getragen worden ist. Der Bundesgerichtshof begründet dies u.a. damit, dass es keine gesetzliche zum Tragen eines Fahrradhelms gibt. Außerdem habe es zum Zeitpunkt des Unfalls auch kein allgemeines Verkehrsbewusstsein gegeben, wonach das Tragen eines Fahrradhelms zum eigenen Schutz erforderlich und zumutbar gewesen wäre. Nach repräsentativen Verkehrsbeobachtungen der Bundesanstalt für Straßenwesen im Jahr 2011 würden innerorts nur elf Prozent der Fahrradfahrer einen Helm tragen.
Dem Urteil des Bundesgerichtshofs ist zuzustimmen. Wer sich gesetzestreu verhält sollte hierfür nicht durch die Anrechnung eines Mitverschuldens „bestraft“ bzw. benachteiligt werden.
Sofern die Kampagne des BMVI und des DVR auch dazu führt, dass mehrere Fahrradfahrer einen Fahrradhelm benutzen, kann es sein, dass die Rechtsprechung diesem Umstand derart Rechnung tragen wird, dass es ggf. ein allgemeines Verkehrsbewusstsein gegeben wird, wonach das Tragen eines Fahrradhelms zum eigenen Schutz erforderlich und zumutbar sein wird. In diesem Fall wäre künftig wohl ein Mitverschulden anzurechnen.
Letztendlich könnte der Gesetzgeber Klarheit schaffen. Würde er eine Fahrradhelmpflicht beschließen, so wäre wohl auch bei durch Fahrradfahrern unverschuldeten Unfällen im Falle des Nichttragens eines Fahrradhelms ein Mitverschulden zu berücksichtigen, sofern der Helm beim konkreten Unfall die Schäden zumindest reduziert hätte.
Fazit:
Unabhängig von der grundsätzlich (noch) für Fahrradfahrer positiven Rechtsprechung sollten diese beachten, dass das Tragen eines Fahrradhelms im eigenen Interesse erfolgen sollte. Ein Schadensersatzanspruch kann immer nur versuchen den erlitten Schaden zu kompensieren, jedoch nicht die Gesundheit wiederherstellen. Dem Präsident des DVR Prof. Dr. Walter Eichendorf ist zuzustimmen „Es gibt nichts Wichtigeres, als die Gesundheit und das eigene Leben zu schützen“. Dem ist nichts hinzuzufügen.