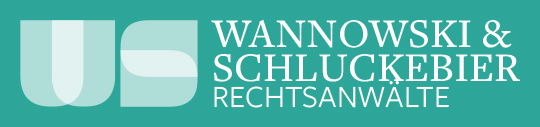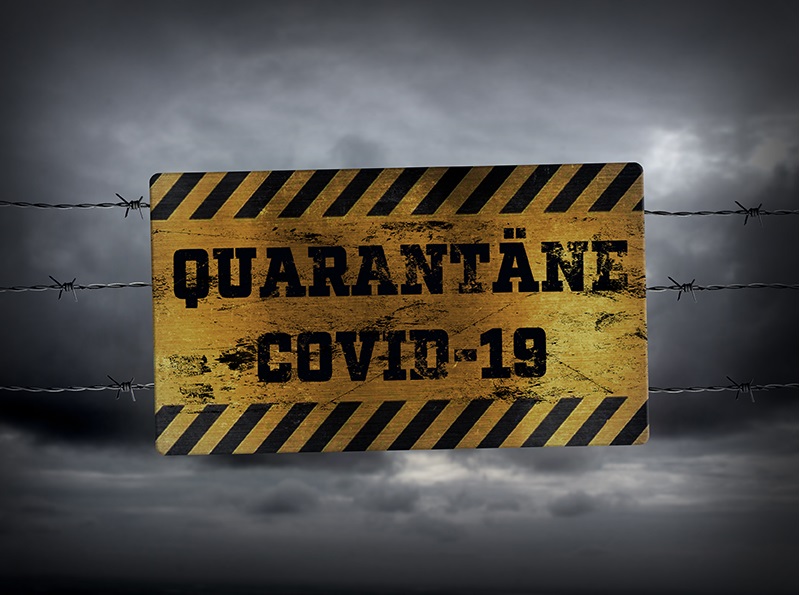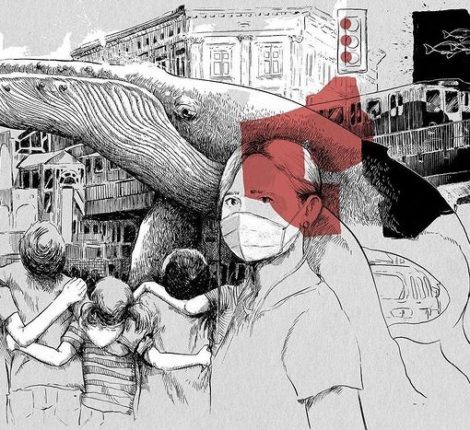Ohne Arbeit kein Lohn (auch) zu Zeiten der Corona-Pandemie? – Teil 1
Das Coronavirus wirkt sich massiv auf viele Arbeitsverhältnisse aus. Im Folgenden wird kursorisch anhand einiger Beispiele der Frage nachgegangen, ob trotz der Corona-Pandemie gearbeitet werden muss und welche Konsequenzen bei nicht erbrachter Arbeitsleistung drohen.
Rechte und Pflichten im Arbeitsverhältnis
Das Arbeitsverhältnis ist durch eine Vielzahl von wechselseitigen Pflichten und Rechten gekennzeichnet. Hierbei wird zwischen Haupt- und Nebenpflichten differenziert. Die Hauptpflichten betreffen den unmittelbaren Leistungsaustausch. Hiernach ist der Arbeitnehmer dazu verpflichtet die geschuldete Arbeitsleistung in dem vereinbarten Umfang an dem ausgemachten Ort zu erbringen. Art und Umfang der Erfüllung der Pflicht zur Erbringung der geschuldeten Arbeitsleistung ergeben sich in erster Linie aus dem Arbeitsvertrag. Häufig treffen auch Tarifverträge und/oder Betriebsvereinbarungen Regelungen hierzu. Selbstverständlich sind auch gesetzliche Vorschriften zu beachten. Dem Arbeitgeber steht regelmäßig zur Konkretisierung der vom Arbeitnehmer geschuldeten Arbeitsleistung das sog. Direktionsrechts des § 106 Satz 1 GewO zu. Hiernach kann der Arbeitgeber Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen näher bestimmen, soweit diese Arbeitsbedingungen nicht durch den Arbeitsvertrag, Bestimmungen einer Betriebsvereinbarung, eines anwendbaren Tarifvertrages oder gesetzliche Vorschriften festgelegt sind. Arbeitsvertragliche Vereinbarungen, Bestimmungen einer Betriebsvereinbarung, eines anwendbaren Tarifvertrages oder gesetzliche Vorschriften gehen somit dem Direktionsrecht vor. Ist beispielsweise im Arbeitsvertrag der Arbeitsort als der Betrieb vereinbart worden, darf durch den Arbeitgeber regelmäßig nicht einseitig Heimarbeit/Home-Office/Telearbeit angeordnet werden. Dies wurde bereits hier ausführlicher dargestellt. Außerdem hat die Ausübung des Weisungsrechts nach billigen Ermessens zu erfolgen. Der Arbeitnehmer hat also bei seinen Entscheidungen über Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung eine Abwägung unter Berücksichtigung der Interessen des Arbeitnehmers und der betrieblichen Interessen durchzuführen. Die Hauptpflicht des Arbeitgebers besteht darin, das geschuldete Arbeitsentgelt zu zahlen. Es gilt der Grundsatz ohne Arbeit kein Lohn. Viele Arbeitgeber und Arbeitnehmer beschäftigen derzeit die Frage, welche Ausnahmen von dem Grundsatz ohne Arbeit kein Lohn gegenwärtig gelten.
Angst vor Krankheiten/Infektionen auf Arbeitnehmerseite
Was passiert also, wenn der Arbeitnehmer sich beispielsweise aus Angst vor einer Infektion mit dem Coronavirus weigert zur Arbeit zu erscheinen? Hierzu ist festzuhalten, dass ihn dies regelmäßig ohne konkrete Ansteckungsgefahr, nicht von seiner Pflicht zur Erbringung der Arbeitspflicht entbindet. Die abstrakte Gefahr krank zu werden gehört zum allgemeinen Lebensrisiko. Der Arbeitgeber muss in diesem Fall regelmäßig nicht den vereinbarten Lohn zahlen. Außerdem drohen dem Arbeitnehmer bei unentschuldigter Arbeitsverweigerung hierüberhinaus weitere arbeitsrechtliche Sanktionen, wie Abmahnung, Kündigung etc..
Angst vor Krankheiten/Infektionen auf Arbeitgeberseite
Will der Arbeitgeber aber etwa aus allgemeiner Angst vor einer Infektion mit dem Coronavirus – ohne konkrete Verdachtsmomente – seine Arbeitnehmer zuhause lassen, ohne dass es eine wirksame Vereinbarung zur Heimarbeit/Telearbeit (s. hier) gibt, muss er auch prinzipiell weiterhin zahlen, selbst wenn der Arbeitnehmer keine Arbeitsleistung erbringt. Dies ergibt sich aus dem Grundsatz des Betriebsrisikos des § 615 S. 3 BGB. Über § 326 Abs. 2 BGB, § 275 BGB gelangt man zum selben Ergebnis, weil der Arbeitnehmer, der seine Arbeitsleistung im Betrieb zu erfüllen hat diese nicht erbringen kann, wenn der Betrieb geschlossen ist. Juristen sprechen in diesem Fall von Unmöglichkeit im Sinne des § 275 BGB. Aus folgt § 326 Abs. 2 BGB, dass der Arbeitnehmer seinen Vergütungsanspruch behält, sofern der Arbeitgeber für den Umstand, auf Grund dessen der Arbeitnehmer nach § 275 BGB nicht zu leisten braucht, allein oder weit überwiegend verantwortlich ist. Schließt der Arbeitgeber etwa aus allgemeiner Angst – ohne konkrete Verdachtsmomente – vor einer Infektion mit dem Coronavirus seinen Betrieb, wird er regelmäßig allein oder weit überwiegend verantwortlich für die Unmöglichkeit der Arbeitsleistungserbringung sein. Folglich behält der Arbeitnehmer seinen Vergütungsanspruch.
Beschäftigungsanspruch
Außerdem ist zu beachten, dass Arbeitnehmern ein Beschäftigungsanspruch zusteht, welcher gerichtlich geltend gemacht werden kann. Grundlage hierfür ist der Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts aus Art. 1 GG, Art. 2 Abs. 1 GG, wonach der Arbeitnehmer sich auch an seinem Arbeitsplatz entfalten und entwickeln können soll. Es ist also generell nicht möglich, Arbeitnehmer einfach grundlos nach Hause zu schicken. Hiervon gibt es aber Ausnahmen. Häufig wird im Arbeitsvertrag die Möglichkeit zur bezahlten Freistellung vereinbart. Auch im Falle von überwiegenden schützenswerten Interessen des Arbeitgebers an der Freistellung besteht der Beschäftigungsanspruch nicht. Überwiegende schützenswerte Interessen des Arbeitgebers an der Freistellung sollten regelmäßig dann vorliegen, wenn eine Gesundheitsgefahr und somit der konkrete Verdacht einer Infizierung vorliegen. Wann aber ein solcher konkreter Verdacht besteht, lässt sich nicht pauschal beantworten und wird immer eine Frage des konkreten Einzelfalls unter Beachtung der jeweiligen (besonderen) Umstände sein.
Entbindung von der Arbeitspflicht
Die Entbindung von der Arbeitspflicht muss vom Arbeitgeber und/oder den staatlichen Behörden angeordnet werden, damit der Arbeitnehmer nicht seinen Lohnanspruch verliert. Somit gilt aber auch, dass eine Entbindung von der Arbeitspflicht durch den Arbeitgeber generell dazu führt, dass dieser auch zahlen muss.
Konkrete Gefahr/erhöhte Gefährdungslage – Krankheit – aktuelle Besonderheiten bei der Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit durch einen Arzt
Wie dargestellt ist der Ausgangsfall anders zu beurteilen, wenn nicht nur die bloße Angst vor einer Infektion im Raum steht, sondern eine erhöhte Gefährdungslage etwa im Betrieb besteht oder der Arbeitnehmer arbeitsunfähig erkrankt ist. Wann und wie lange man arbeitsunfähig erkrankt ist, hat grundsätzlich ein Arzt im Rahmen einer persönlichen Untersuchung zu entscheiden. Hiervon gibt es derzeit eine bedeutsame Ausnahme: In Fällen, in denen bei den Versicherten eine Erkrankung der oberen Atemwege vorliegt, welche keine schwere Symptomatik vorweist, dürfen Ärzte mittlerweile auch ausnahmsweise ohne vorherige persönliche Untersuchung Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für bis zu 14 Tage (anfangs bis zu 7 Tage) ausstellen. Die entsprechende Sonderregelung gilt voraussichtlich bis zum 23. Juni 2020. Derzeit ist sie bis dahin befristet.
Die Arbeitsunfähigkeit muss dem Arbeitgeber aber nach wie vor unverzüglich mitgeteilt werden. Insbesondere sind die bei Arbeitsunfähigkeit im Betrieb geltenden Regelungen sowie die entsprechenden Gesetze auch weiterhin einzuhalten. Arbeitsunfähig erkrankten Arbeitnehmern steht generell für die Dauer von bis zu sechs Wochen ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung gegenüber ihrem Arbeitgeber nach § 3 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) und danach für gewisse Zeit auf Krankengeld von der Krankenkasse zu.
Auch im Falle eines begründeten Verdachts, sich mit dem Corona-Virus angesteckt zu haben, wird regelmäßig vom Vorliegen eines sogenannten vorübergehenden persönlichen Verhinderungsgrundes im Sinne § 616 S.1 BGBauszugehen sein. Hiernach wird der Arbeitnehmer grundsätzlich nicht eines Vergütungsanspruchs dadurch verlustig, dass er für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an Arbeit verhindert wird. Aber Vorsicht: § 616 S.1 BGB kann durch Tarif- oder Arbeitsvertrag sowie unter den Voraussetzungen des § 77 Abs. 3 BetrVG auch ausgeschlossen oder beschränkt werden!
Freistellung
Ein klarer Fall in dem Arbeitnehmer ihren Vergütungsanspruch behalten ist die Freistellung durch den Arbeitgeber, welche aber grundsätzlich nicht ohne entsprechende Vereinbarung einseitig angeordnet werden darf (s. oben).
Wegerisiko
Fälle in dem Arbeitnehmer grundsätzlich nicht zahlen muss, werden von sogenannten Wegerisiko erfasst. Hiernach ist es prinzipiell Sache des Arbeitnehmers, wie er zur Arbeitsstelle gelangt. Grund hierfür ist § 616 S.1 BGB. Dieser knüpft an einen in der Person des Arbeitnehmers liegenden Grund an. Der unverschuldete Verhinderungsgrund muss sich somit also speziell auf den Arbeitnehmer als Person beziehen muss. Hierunter fallen u.a. die Krankheit des Arbeitnehmers wie auch persönliche Unglücksfälle des Arbeitnehmers. Allgemeine durch höhere Gewalt hervorgerufen Verhinderungsgründe führen jedoch regelmäßig zum Verlust des Vergütungsanspruches. Höhere Gewalt erfasst im Arbeitsrecht Situationen, die außerhalb der Verantwortung und Einwirkungsmöglichkeit sowohl des Arbeitnehmers, als auch des Arbeitgebers liegen. Sofern der Arbeitnehmer beispielsweise auf Grund von Ausfällen im öffentlichen Verkehr infolge der Corona-Pandemie nicht oder nicht pünktlich zur Arbeit erscheint und daher seine Arbeitsleistung entweder nicht oder nur gemindert erbringt, steht ihm regelmäßig auch kein bzw. nur ein geminderter Lohn zu. Im Fall des Nichterbringens der Arbeitsleistung entfällt somit der Anspruch auf Vergütung. Kann die Arbeitsleistung nur gemindert erbracht werden, vermindert sich entsprechend die Vergütung.
Auftrags- und/oder Rohstoffmangel
Was geschieht, wenn keine Arbeit für den Arbeitnehmer zur Verfügung steht, weil beispielshalber Lieferanten nicht liefern und/oder derzeit keine Aufträge vorhanden sind? Hierbei gilt das sog. Wirtschaftsrisiko, welches generell der Arbeitgeber trägt. Der Umstand, dass der Arbeitgeber die vom Arbeitnehmer angebotene Arbeitsleistung nicht verwerten kann, fällt somit in den Risikobereichs des Arbeitgebers. Er muss also in diesen Fällen regelmäßig weiterhin den Lohn zahlen.
Sonstige Fälle
Was in den Fällen, von beispielsweise Betriebsschließungen, beruflichen Tätigkeits-/Beschäftigungsverboten und anderen Konstellationen, in den nicht gearbeitet werden kann/darf/wird, gilt, wird in weiteren Blogeinträgen thematisiert werden.
Fazit
Auch die scheinbare einfache Frage, ob trotz der Corona-Pandemie auch der Grundsatz ohne Arbeit kein Lohn gilt, zeigt, dass dies regelmäßig eine Frage des konkreten Einzelfalls mit diversen Aspekten ist, die sich nicht pauschal beantworten lässt. Klare – ggf. aufgrund der aktuellen Situationen neu zu treffende – Vereinbarungen sind sehr ratsam, um sich in der derzeitigen Lage zu unterstützen und arbeitsrechtliche Sanktionen zu verhindern. Temporäre Regelungen erscheinen vor dem Hintergrund der derzeitigen außergewöhnlichen Umstände zweckmäßig. Vor der Änderung der arbeitsrechtlichen Pflichten sollte stets sorgsam geprüft werden, auf was sich eingelassen wird und welche Rechte hierdurch geändert werden. Es empfiehlt sich somit, sich sowohl als Arbeitgeber, als auch als Arbeitnehmer von einem spezialisierten Rechtsanwalt beraten zu lassen.