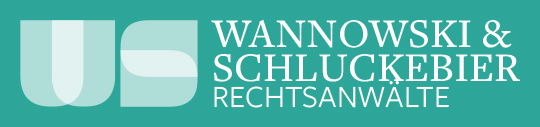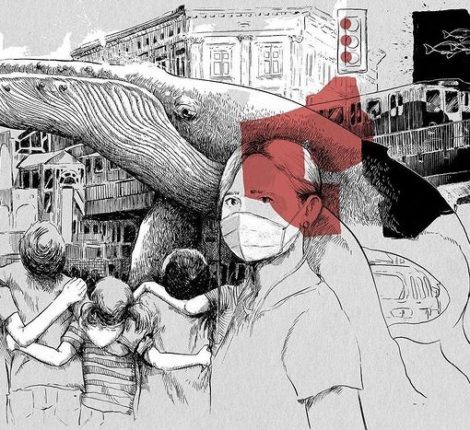Zur außerordentlichen Kündigung eines Call-Center-Agenten, der Telefonate trotz entgegenstehender Weisung mit „Jesus hat Sie lieb“ beendete
Ostern wird die Auferstehung Jesu Christi gefeiert. Art. 4 GG gewährleistet verfassungsrechtlich Jedermann die Glaubens- und Religionsfreiheit. Art. 4 Abs. 1 GG statuiert, dass die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses unverletzlich sind. Gemäß Art. 4 Abs. 2 GG wird die ungestörte Religionsausübung gewährleistet. Aufgrund dieses verfassungsrechtlichen Schutzes und der Tatsache, dass Religion für viele Menschen eine große Bedeutung in ihrem Leben hat, spielt der Glaube auch im Arbeitsrecht immer wieder eine Rolle.
Im am 20. April 2011 vom Landesarbeitsgericht Hamm – 4 Sa 2230/10 – entschiedenen Fall stritten die Parteien über die Wirksamkeit einer außerordentlichen, hilfsweise ordentlichen arbeitgeberseitigen Kündigung.
Was war passiert?
Der Arbeitgeber betrieb ein Call-Center. Der Arbeitnehmer war seit Ende Juni 2004 sechs Stunden wöchentlich in Teilzeit als Telefonagent beschäftigt und hatte telefonische Warenbestellungen entgegenzunehmen. Der Ablauf der Telefonate war durch ein Standardskript in wesentlichen Teilen arbeitgeberseits vorgegeben. Die Verabschiedung sollte danach entweder „Ich danke Ihnen für Ihre Bestellung bei …! Auf Wiederhören“, oder „Ich danke für Ihre Bestellung bei … und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag/Abend! Auf Wiederhören“ lauten.
Der Arbeitgeber erlangte durch Supervisoren Kenntnis davon, dass der Arbeitnehmer im Januar 2010 mehrfach Telefonate mit Kunden mit den Worten „Jesus hat Sie lieb! Vielen Dank für Ihren Einkauf bei Q1 und einen schönen Tag!“ beendete. Dies nahmen zwei Supervisoren zum Anlass, den Arbeitnehmer darauf hinzuweisen, dass die von ihm gewählte Verabschiedung nicht den Vorgaben des Standardskripts entsprach.
Der Arbeitnehmer berief sich darauf, dass er sowohl Verpflichtungen gegenüber dem Arbeitgeber, als auch gegenüber Gott nachkommen müsse. Nur durch die von ihm gewählte Verabschiedungsformel könne er beiden Verpflichtungen gerecht werden.
Selbst als ihm eine derartige Verabschiedung untersagte und anderenfalls die Beendigung des Arbeitsverhältnisses angedrohte wurde, erklärte der Arbeitnehmer, dass er aufgrund seiner tiefen religiösen Überzeugung dieser Weisung nicht folgen könne. Er sei bereit, dafür alle Konsequenzen zu tragen.
Mitarbeiter der Personalverwaltung führten mit dem Arbeitnehmer ein weiteres Gespräch, in dem dieser auf seiner Haltung beharrte. Der Arbeitnehmer wollte jedoch überlegen, ob er von sich aus das Arbeitsverhältnis kündige.
Der Arbeitnehmer wurde daraufhin von seiner Verpflichtung zur Arbeitsleistung vorläufig freigestellt und darum gebeten, dem Arbeitgeber seine Entscheidung mitzuteilen.
Ende Januar 2010 fand ein letztes Gespräch zwischen dem Arbeitnehmer und Vertretern des Arbeitgebers statt, in dem ihm nochmals dargelegt wurde, dass eine Weiterbeschäftigung nicht möglich sei, sofern er die von ihm verwendete Abschiedsformel künftig nicht unterlasse. Der Arbeitnehmer entgegnete, er werde sein Verhalten nicht ändern, wolle aber am Arbeitsverhältnis festhalten, um den Glauben Gottes verbreiten zu können.
Daraufhin hörte der Arbeitgeber den Betriebsrat zu einer beabsichtigten außerordentlichen, hilfsweise ordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses an. Der Betriebsrat widersprach den beabsichtigten Kündigung(en). Der Arbeitgeber kündigte das Arbeitsverhältnis durch Schreiben vom 3. Februar 2010 fristlos, hilfsweise ordentlich zum 30. April 2010.
Entscheidung des Arbeitsgerichts Bochum
In der ersten Instanz vor dem Arbeitsgericht Bochum gewann der Arbeitnehmer. Das Arbeitsgericht Bochum hat festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien durch die Kündigung nicht beendet worden ist.
Der Arbeitnehmer führte daraufhin einen gesonderten Rechtsstreit, in dem er einen Beschäftigungsanspruch geltend machte. Im Rahmen dieses Verfahrens erklärte er, dass er dazu bereit sei, bis zu einer Entscheidung des Kündigungsschutzrechtsstreits durch das Landesarbeitsgericht auf den christlichen Zusatz in Telefonaten zu verzichten.
Wenige Tage vor der mündlichen Verhandlung im Berufungsverfahren vor dem Landesarbeitsgericht Hamm rief der Arbeitnehmer persönlich bei der Geschäftsstelle des Landesarbeitsgerichts an, um sich zu erkundigen, ob ihm für die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung Reisekosten gewährt werden könnten. Er beendete dieses Telefonat ohne religiösen Zusatz.
Gerichtliche Argumentation des Arbeitnehmers
Der Arbeitnehmer berief sich in den Gerichtsverfahren im Wesentlichen darauf, dass seit langem bekannt sei, dass er tief religiös sei. Es gehe ihm allein um den Hinweis an die Kunden, dass Christus jeden Menschen liebe. Wie die Kunden hiermit umgehen würden sei ihre Sache. Nicht in einem einzigen Fall sei es zu einer negativen Reaktion gekommen.
Gerichtliche Argumentation des Arbeitgebers
Der Arbeitgeber hat demgegenüber in den Gerichtsverfahren im Wesentlichen vorgetragen, dass die erfolgte Anweisung, von seinem Direktionsrecht gedeckt gewesen sei. Durch das Nichtbefolgen dieser Anweisung habe der Arbeitnehmer in erheblichem Umfang gegen seine arbeitsvertraglichen Pflichten verstoßen. Es sei ihm zwar zuzugestehen, dass sein Verhalten auch während der Arbeit von seiner Glaubensüberzeugung bestimmt werde. Diese Freiheit werde aber durch die Berufsausübungsfreiheit gemäß Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG begrenzt. Der Arbeitgeber habe ein berechtigtes Interesse daran, dass Kunden an Äußerungen von Call-Agenten keinen Anstoß nähmen und aus diesem Grund Telefongespräche ohne politische oder religiöse Meinungsäußerungen der Telefonagenten erfolgen müssten. Es sei naheliegend, dass Äußerungen, die nicht im Zusammenhang mit dem Kaufgeschäft stünden, zu einer Verärgerung von Kunden führen könnten. Dem Arbeitnehmer sei es zuzumuten, auf diese Interessen Rücksicht zu nehmen, weil ansonsten Aufträge und/oder Kunden gänzlich verloren gehen könnten.
Das Arbeitsgericht Bochum hat durch Urteil vom 8. Juli 2010 festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien durch die Kündigung nicht beendet worden ist.
Begründung des Arbeitsgerichts Bochum
Zur Begründung äußerte das Arbeitsgericht Bochum formelle Bedenken in Bezug auf die Betriebsratsanhörung, welche zur Rechtsunwirksamkeit der streitbefangenen Kündigung(en) führten. Außerdem sei die vom Arbeitnehmer bei der Verabschiedung von Kunden verwendete von seinem christlichen Glauben geprägte Verabschiedungsformel von dem Arbeitgeber hinzunehmen. Der Arbeitnehmer schulde keinen bedingungslosen Gehorsam. Die Berufsausübungsfreiheit des Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG des Arbeitgebers müsse vorliegend hinter der durch Art. 4 Abs. 1 und 2 GG geschützten Glaubens- und Bekenntnisfreiheit zurückstehen. Eine reale Gefährdung des Erwerbsinteresses habe der Arbeitgeber nicht darzustellen vermocht. Die bloße Befürchtung, es könne aufgrund des christlich geprägten Grußes zu Konflikten zwischen Anrufern und anderen Telefonisten kommen, sei keine ausreichende Grundlage, um die religiösen Grundrechte des Arbeitnehmers zu verdrängen. Was für das islamische Kopftuch gelte, habe erst Recht für den christlich geprägten Abschiedsgruß zu gelten.
Berufungsverfahren
Der Arbeitgeber hat form- und fristgerecht Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil eingelegt.
Weitere Argumentation des Arbeitgebers
Der Arbeitgeber äußerte sich in der zweiten Instanz zunächst zu den formellen Bedenken der Kündigung(en). Außerdem sei die Ansicht des Arbeitsgerichts Bochums, wonach die vom Arbeitnehmer bei der Verabschiedung von Kunden verwendete Verabschiedungsformel hinzunehmen sei rechtsfehlerhaft. Ob eine reale Gefährdung vorliege, sei irrelevant, weil ihr ein Nachweis über konkrete Beschwerden nicht möglich sei. Augenscheinlich sei, dass sich weltanschauliche oder religiöse Äußerungen im Rahmen eines Kaufgeschäftes störend auf Kundenbeziehungen auswirkten, weil sie sehr ungewöhnlich seien. Arbeitgeber hätten ein berechtigtes Interesse daran, dass Kaufgespräche sachlich verliefen. Der Arbeitnehmer sei nicht berechtigt gewesen, sich den Arbeitsanweisungen des Arbeitgebers beharrlich zu widersetzen. Die Zuweisung des Inhalts der Arbeitsleistung sei durch das Direktionsrecht gedeckt gewesen, weil damit das legitime Ziel verfolgte wurde, Konflikte mit Kunden und Diskussionen zu vermeiden. Die Kaufabwicklung sei nicht das geeignete Forum, um weltanschauliche oder religiöse Ansichten zu verbreiten oder diese zu diskutieren. Die Grundrechtsbeeinträchtigung des Arbeitnehmers habe keine erhebliche Intensität, weil dieser nur eine geringe zeitliche Einschränkung der von ihm in Anspruch genommenen Religionsausübung erfahre, da er lediglich sechs Stunden wöchentlich in Teilzeit beschäftigt worden sei. Da der Arbeitgeber sich beharrlich weigere, sich neutral von Kunden zu verabschieden und zudem das Arbeitsverhältnis als Medium zur Verbreitung seines Glaubens nutze, sei dem Arbeitgeber eine Weiterbeschäftigung nicht zumutbar.
Weitere Argumentation des Arbeitnehmers
Der Arbeitnehmer verteidigte die erstinstanzliche Entscheidung. Er führte ergänzend aus, dass er als gläubiger Christ verpflichtet sei, stets seinen Glauben zu bekunden und weiterzutragen. Die Art und Weise, wie er dies tue, stelle in keiner Weise eine Belästigung dar. Der Arbeitgeber halte statistisch genau fest, bei welchen Mitarbeitern es wie viele Vertragsschlüsse gebe und insbesondere auch, wie viele Verträge unter Rückgabe der Waren innerhalb der gesetzlichen Frist rückabgewickelt würden. Im Verhältnis zu seinen Kollegen habe es dabei zu keinerlei Beeinträchtigungen gegeben.
Mündliche Verhandlung
Im Rahmen der mündlichen Verhandlung vom 20.04.2011 gab die Kammer dem Arbeitnehmer Gelegenheit, seine religiösen Überzeugungen darzulegen. Er erklärte dazu u.a., dass er nach einem persönlichen Erlebnis irgendwann nach dem Jahr 2008 dazu übergegangen sei, die fragliche Verabschiedungsformel aufgrund seiner christlichen Überzeugung zu verwenden. Ergänzend erklärte der Prozessbevollmächtigte des Arbeitnehmers, dass der Arbeitnehmer sich allein vor dem Hintergrund erheblicher finanzieller Belastungen für eine vorübergehende Zeit bereiterklärt hätte, auf die religiöse Verabschiedung zu verzichten.
Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Hamm
Das Landesarbeitsgericht Hamm kam zu dem Ergebnis, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien durch wirksame außerordentliche Kündigung endete.
Außerordentliche Kündigung – wichtiger Grund
Nach ständiger Rechtsprechung kann ein Arbeitsverhältnis gemäß § 626 Absatz 1 BGB aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und bei Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses selbst bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Dies hat anhand einer zweistufigen Prüfung zu erfolgen. Im ersten Schritt ist zu untersuchen, ob der Sachverhalt ohne seine besonderen Umstände typischerweise geeignet sein kann, eine außerordentliche Kündigung zu rechtfertigen. Im zweiten Schritt ist festzustellen, ob dem Kündigenden angesichts der konkreten Umstände des konkreten Einzelfalles eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses – jedenfalls bis zum Ablauf der Kündigungsfrist – zuzumuten ist oder nicht.
Dadurch, dass der Arbeitnehmer es strikt ablehnte, bei Telefonaten den vom Arbeitgeber vorgegebenen Abschiedsgruß ohne einen religiösen Zusatz zu verwenden, weigerte er sich beharrlich, die ihm aus dem Arbeitsvertrag obliegenden Vertragspflichten zu beachten. Damit hat er unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass er auch zukünftig nicht bereit gewesen ist, die diesbezügliche arbeitgeberseitige Weisung zu beachten.
Direktionsrecht des § 106 Satz 1 GewO
Gemäß § 106 Satz 1 GewO kann der Arbeitgeber Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen näher bestimmen, soweit diese Arbeitsbedingungen nicht durch den Arbeitsvertrag, Bestimmungen einer Betriebsvereinbarung, eines anwendbaren Tarifvertrags oder gesetzliche Vorschriften festgelegt sind. Aufgrund seines Weisungsrechts darf der Arbeitgeber somit einem Arbeitnehmer einseitig bestimmte Arbeiten unter Beachtung billigen Ermessens im Sinne von § 315 Abs. 3 BGB zuweisen, sofern das Weisungsrecht nicht durch Gesetz, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder Einzelarbeitsvertrag eingeschränkt ist.
Das Landesarbeitsgericht Hamm hielt fest, dass die arbeitgeberseitige Weisung, Kundengespräche mit einer standardisierten Verabschiedungsformel zu beenden, vom arbeitgeberseitigen Direktionsrecht nach § 106 Satz 1 GewOgedeckt war. Eine Einschränkung des Direktionsrechts durch Arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarung, Tarifvertrag oder Gesetz war im vorliegenden Fall nicht ersichtlich. Die Weisung, bei der Verabschiedung von Kunden auf religiöse Zusätze zu verzichten, war dem Arbeitnehmer zuzumuten und sie verstieß auch nicht gegen billiges Ermessen.
Glaubens- und Religionsfreiheit
Das Landesarbeitsgericht Hamm führte aus, dass der Arbeitgeber bei der Ausübung seines Weisungsrechts die durch Art. 4 Abs. 1 und 2 GG grundrechtlich geschützte Glaubensfreiheit des Arbeitnehmers beachten und auf einen dem Arbeitgeber gegenüber offenbarten Glaubens- oder Gewissenskonflikt Rücksicht nehmen muss. Zu der nach Art. 4 Abs. 1 und 2 GG verfassungsrechtlich geschützten Glaubens- und Religionsfreiheit gehört nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch das Recht des Einzelnen, sein gesamtes Verhalten an den Lehren seines Glaubens auszurichten und seiner inneren Glaubensüberzeugung gemäß zu handeln. Das zu beurteilende Verhalten muss nicht allgemein von den Gläubigen geteilt werden. Für eine wirksame Berufung auf Art. 4 Abs. 1 und 2 GG kommt es ausschließlich darauf an, dass es überhaupt von einer wirklich religiösen Überzeugung getragen und nicht anders motiviert ist. Allerdings wird auch nicht jede Handlung, die im weitesten Sinn auf religiöse Ansichten zurückgeführt werden kann, durch die Glaubensfreiheit geschützt. Als relevante Handlungen sind Gewissensentscheidungen anzuerkennen. Eine Gewissensentscheidung ist jede ernstliche sittliche Entscheidung, die der Einzelne in einer bestimmten Lage als für sich bindend und unbedingt verpflichtend innerlich erfährt und gegen die er nicht ohne ernste Gewissensnot handeln könnte. Im Streitfallfall muss der Arbeitnehmer seine Entscheidung im Einzelnen darlegen oder erläutern. Es muss hierbei erkennbar sein, dass es sich um eine nach außen tretende, rational mitteilbare und intersubjektiv nachvollziehbare Tiefe, Ernsthaftigkeit und absolute Verbindlichkeit einer Selbstbestimmung handelt.
Wesentliche Würdigung durch das Landesarbeitsgericht Hamm
Dies bedeutet allerdings nicht, dass jede Weisung, die irgendeine Berührung mit einer Glaubens- oder Gewissensentscheidung hat, unwirksam wäre. Gemessen an den zuvor erläuterten Grundsätzen vermochte der Arbeitnehmer aus Sicht des Landesarbeitsgerichts Hamm nicht nachvollziehbar darzulegen, dass er in eine ernste Gewissensnot geraten würde, wenn er bei der Verabschiedung von Kunden dem Arbeitgeber davon absähe, auf den von ihm gewählten religiösen Zusatz zu verzichten.
Das Landesarbeitsgericht Hamm fand deutliche Worte und führte u.a. aus, dass bereits die Begründung des Arbeitnehmers, aufgrund der er sich gehalten sah, den religiösen Zusatz zu verwenden, wenig anschaulich und letztlich nicht nachvollziehbar sei. Sein Vortrag sei zu pauschal. Obwohl in der Bundesrepublik Deutschland zahlreiche gläubige Christen lebten, würde es nach dem Kenntnisstand der Kammer niemand für sich als verpflichtend ansehen, wie der Arbeitnehmer zu handeln. Aufgrund dieser Besonderheit hätte man von dem Arbeitnehmer erwarten müssen, dass er der Kammer seine Glaubensüberzeugung näher darlegen könne. Dies vermochte er jedoch auch im Rahmen der mündlichen Verhandlung nicht. Hinzu kam, dass es konkreten Anlass gab, an einem unlösbaren Gewissenskonflikt des Arbeitnehmers bei Beachtung der arbeitgeberseitigen Weisung zu zweifeln, weil er ein Telefonat mit der Geschäftsstelle des Landesarbeitsgerichts ohne religiösen Zusatz beendete. Außerdem hatte sich der Arbeitnehmer im Rahmen eines weiteren Verfahrens dazu bereit erklärt, dass er bis zu einer Entscheidung des Kündigungsschutzrechtsstreits auf den christlichen Zusatz in Telefonaten verzichten könnte. Hiermit ließe sich das Vorliegen eines Gewissenskonflikts jedoch nicht plausibel erklären. Bei einem unauflöslichen Gewissenskonflikt wäre es nach Auffassung der Kammer vielmehr zu erwarten gewesen, dass der Arbeitnehmer an seinem Standpunkt festhält und auch während einer etwaigen Prozessbeschäftigung für sich in Anspruch nimmt, die religiöse Abschiedsformel weiter zu verwenden, zumal er in erster Instanz den Prozess gewonnen habe. Es sei schwer erklärlich, weshalb es ihm nicht möglich sein soll, sich generell im Rahmen des Arbeitsverhältnisses der arbeitgeberseitigen Weisung bezüglich der Art und Weise der Beendigung von Telefonaten mit Kunden zu beugen, wenn finanzielle Gründe es ihm aus seiner Sicht erlauben, zumindest vorübergehend von seiner Verabschiedungsformel Abstand zu nehmen.
Da der Arbeitnehmer die Kammer nicht davon überzeugen konnte, dass er subjektiv mit einer absoluten Verbindlichkeit gehalten wäre, Telefonate mit der dargestellten Formel zu beenden, war es ihm zuzumuten, der diesbezüglichen arbeitgeberseitigen Weisung Folge zu leisten.
Somit war im vorliegenden Fall die Ausübung des arbeitgeberseitigen Direktionsrechts rechtmäßig und vom billigen Ermessen getragen.
Da der Arbeitnehmer sich weigerte auf die Grußformel zu verzichten lag eine beharrliche Arbeitsverweigerung vor, so dass der Arbeitnehmer an sich berechtigt war, das Arbeitsverhältnis außerordentlich nach § 626 Abs. 1 BGB zu kündigen.
Abmahnung
Auch musste keine (weitere) Abmahnung erfolgen. Unabhängig von der Frage, ob der Arbeitnehmer abgemahnt worden ist, war eine Abmahnung jedenfalls entbehrlich, weil sie nicht geeignet gewesen wäre, den Arbeitnehmer zu einem vertragsgerechten Verhalten zu bewegen.
Interessenabwägung
Das Landesarbeitsgericht Hamm stellte fest, dass die erforderliche Interessenabwägung dazu führte, dass das Interesse des Arbeitgebers an einer sofortigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegenüber dem Interesse des Arbeitnehmers, das Arbeitsverhältnis zumindest bis zum Ablauf der Frist für eine ordentliche Kündigung fortzusetzen, überwiegte.
Die formellen Bedenken des Arbeitsgerichts Bochum konnte der Arbeitgeber in zweiter Instanz durch Vorlage eines Anhörungsbogen zur Betriebsratsanhörung ausräumen. Weitere Anhaltspunkte für eine unvollständige oder sonst unwirksame Betriebsratsanhörung waren auch nicht geltend gemacht worden.
Bezüglich der weiteren Details wird auf das Urteil des Landesarbeitsgerichts Hamm vom 20. April 2011 – 4 Sa 2230/10 – verwiesen.
Fazit
Der erläuterte Fall zeigt anschaulich, wie unterschiedlich Fälle von Arbeitsgerichten beurteilt werden können. Es empfiehlt sich daher, sich sowohl als Arbeitgeber, als auch als Arbeitnehmer von einem spezialisierten Rechtsanwalt beraten und vertreten zu lassen.