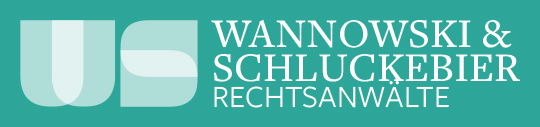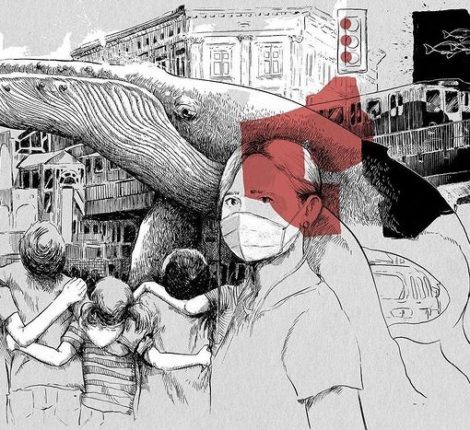Berlin, Berlin – wir fahren nach Berlin! – DFB-Pokalfinale findet im Jahr 2020 nicht wie geplant statt
Fußballfans riefen im Rahmen von DFB-Pokalspielen immer wieder – häufig in Vorfreude auf das Pokalfinale – „Berlin, Berlin – wir fahren nach Berlin!“ Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat am 24. April 2020 entschieden, dass das für den 23. Mai 2020 angesetzte DFB-Pokalfinale in diesem Jahr verlegt wird. Ob und ggf. wann das Pokalfinale stattfinden kann, hängt von der Entscheidung der zuständigen Behörde(n) ab. In einem meiner Arbeitsrechtsstreitigkeiten vor dem Arbeitsgericht Berlin spielte das damalige DFB-Pokalfinale eine entscheidende Rolle …
Was war passiert?
Der Arbeitnehmer war arbeitsunfähig erkrankt. Während der Krankheit fand das DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion statt. Der Arbeitnehmer schoss vor dem Stadion Fotos und veröffentlichte diese in sozialen Medien. Als der Arbeitgeber hiervon erfuhr, reagierte er mit einer schriftlichen ordentlichen Kündigung.
Was kann/muss der Arbeitnehmer nach Erhalt einer Kündigung machen?
Zunächst ist zu beachten, dass gemäß § 4 Kündigungsschutzgesetz (KSchG) der Arbeitnehmer gegen eine Arbeitgeberkündigung generell nur innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung Klage beim Arbeitsgericht erheben kann. Verpasst er diese Frist, gilt die Kündigung gemäß § 7 KSchG grundsätzlich als von Anfang an rechtswirksam. Ein Vorgehen gegen die Kündigung ist danach prinzipiell nicht mehr möglich.
In dem von mir geführten Verfahren wurde die Klagefrist selbstverständlich eingehalten.
Zugang der Kündigung
In Bezug auf den Zugang unterscheidet das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) zwischen Willenserklärungen unter Anwesenden und unter Abwesenden.
Sofern die Kündigung persönlich übergeben wird, geht die Kündigung regelmäßig zum Zeitpunkt der Übergabe bzw. an dem Tag der Übergabe zu. Juristen bezeichnen dies als Willenserklärung unter Anwesenden.
Problematischer ist die Bestimmung des Zugangs, wenn die Kündigung nicht persönlich übergeben wird. Juristen bezeichnen dies als Willenserklärung unter Abwesenden. Zugang unter Abwesenden im Sinne des § 130 Absatz 1 Satz 1 BGB liegt vor, wenn die Kündigungserklärung derart in den sogenannten Machtbereich des Empfängers gelangt ist, dass dieser von ihr Kenntnis nehmen kann und bei Annahme gewöhnlicher Verhältnisse damit zu rechnen ist, dass von ihr Kenntnis erlangt werden kann. Hierbei kommt es also einerseits auf die Möglichkeit der Kenntnisnahme sowie auf die Verkehrsanschauung an. Bei einer in den Briefkasten eingeworfenen Kündigung kommt es immer auf die konkreten Umstände des Einzelfalls an. Hierbei spielen regionale Unterschiede häufig eine Rolle. Es ist somit immer zu prüfen, wann die Kündigung in den Briefkasten eingeworfenen worden ist und wann unter Berücksichtigung der Verkehrsanschauung mit einer Entleerung des Briefkastens im konkreten Fall zu rechnen ist.
In dem von mir geführten Verfahren gab es keine ernsthaften Zweifel an dem fristgemäßen Zugang der Kündigungserklärung.
Form der Kündigung
Eine Kündigung muss außerdem wirksam erklärt worden sein. Gemäß § 623 BGB bedarf die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses der Schriftform. Aus § 126 Absatz 1 BGB ergibt sich, dass hierfür eine eigenhändige Unterschrift erforderlich ist. Ein Dokument ohne Unterschrift, ein per Fax oder E-Mail übermitteltes Dokument erfüllen dieses Kriterium nicht. Eine Kündigung, welche die Schriftform nicht einhält, ist grundsätzlich unwirksam. Es empfiehlt sich jedoch sich auch in diesem Fall zeitnah anwaltlich beraten zu lassen, weil diebzgl. diverse (Prozess)taktiken berücksichtigt werden sollten.
In dem von mir geführten Verfahren wurde die Kündigung (form-)wirksam erklärt.
allgemeiner Kündigungsschutz
Voraussetzungen für den sogenannten allgemeinen Kündigungsschutz ist, dass das Arbeitsverhältnis länger als 6 Monate bestanden hat und im Betrieb des Arbeitgebers regelmäßig mehr als 10 Mitarbeiter beschäftigt werden. Auch diese Voraussetzungen lagen in dem von mir geführten Verfahren vor.
besonderer Kündigungsschutz / Sonderkündigungsschutz
Daneben gibt es noch den sogenannten besonderen bzw. Sonderkündigungsschutz. Dieser kann Schwangeren, Arbeitnehmern in Elternzeit/Elternteilzeit, Betriebsratsmitgliedern, Datenschutzbeauftragten, Schwerbehinderten bzw. diesen gleichgestellten Menschen zustehen.
Kündigungsgrund
Fraglich war, ob ein Kündigungsgrund vorlag. Im Falle von einer Kündigung während der Krankheit kommen regelmäßig zwei Kündigungsgründe in Betracht: Einerseits das Vortäuschen einer tatsächlich nicht bestehenden Krankheit sowie andererseits ein Verhalten während der Arbeitsunfähigkeit, das den Heilungserfolg der Krankheit gefährdet.
Aus Arbeitgebersicht können diesbzgl jedoch regelmäßig nur Vermutungen angestellt werden, weil dem Arbeitgeber grundsätzlich nur bekannt ist, dass sein Arbeitnehmer arbeitsunfähig erkrankt ist. Die Gründe hierfür, wie auch die konkrete Erkrankung sind dem Arbeitgeber meistens unbekannt. Der Arbeitnehmer muss diese dem Arbeitgeber gegenüber auch grundsätzlich nicht offenbaren.
Außerdem ist zu berücksichtigen, dass nicht jedes Verhalten trotz Krankheit arbeitsrechtlich verboten ist. Nicht jede Krankheit führt dazu, dass während der Zeit der Arbeitsunfähigkeit Bettruhe einzuhalten ist. Je nach Art und Intensität der Erkrankung sind auch körperliche Tätigkeiten durchaus möglich bzw. sogar medizinisch geboten. Welches Verhalten bei einer Krankheit erlaubt ist und welches nicht, kommt somit immer auf den konkreten Einzelfall an.
Das Vortäuschen einer tatsächlich nicht bestehenden Krankheit stellt prinzipiell einen Kündigungsgrund dar und berechtigt häufig auch zur außerordentlichen fristlosen Kündigung. Problematisch ist hierbei in der Praxis jedoch auch, ob der Arbeitgeber beweisen kann, dass eine Krankheit tatsächlich nur vorgetäuscht worden ist. Für die Ausstellung einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (kurz AU) gelten hohe formale Anforderungen. Der Arzt muss sich hiernach u.a. ein Bild von der aktuell ausgeübten Tätigkeit und den hiermit zusammenhängenden Anforderungen und Belastungen machen, um beurteilen zu können, ob der Arbeitnehmer seine derzeitige Tätigkeit wegen seiner Erkrankung nicht mehr ausüben kann und ggf. wie lange dies voraussichtlich dauern wird. Hinzu kommt, dass die arbeitsrechtliche Rechtsprechung den Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung generell einen sehr hohen Beweiswert zukommen lässt, der Gegenbeweis folglich häufig schwer zu führen ist. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die arbeitsrechtliche Rechtsprechung zu Recht hohe Anforderungen an eine sogenannte Verdachtskündigung stellt. Hierzu ist zunächst ein schwerwiegender Verdacht einer arbeitsvertraglichen Verfehlung erforderlich. Dieser Verdacht muss sich auf objektiven Tatsachen beruhen. Außerdem muss der Verdacht dringend sein. Schließlich muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmer vor einer Verdachtskündigung anhören und hiervor den Sachverhalt grundsätzlich ausführlich ermitteln.
Möglicherweise aufgrund dieser hohe Hürden wurde in dem von mir geführten Verfahren keine außerordentliche fristlose (Verdachts-)Kündigung, sondern eine ordentliche ausgesprochen.
Jedoch auch ein gesundungswidriges Verhalten kann eine arbeitsrechtliche Pflichtverletzung darstellen, die zu einer ordentlichen Kündigung berechtigen kann. Alles was aus medizinischer Sicht die Gesundung verzögern kann, kann Konsequenzen nach sich ziehen.
Wenn man sich unsicher ist, ob eine Tätigkeit die Gesundung verzögern kann, sollte man den behandelnden Arzt fragen.
Aber auch Arbeitgeber stehen nicht vollständig schutzlos dar: Bei begründeten Zweifeln an der Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers, ist dieser grundsätzlich auf Veranlassung durch den Arbeitgeber dazu verpflichtet an einer Überprüfung durch den Medizinischen Dienst der gesetzlichen Krankenkassen mitzuwirken.
Beides war in dem von mir geführten Verfahren jedoch nicht der Fall.
Eine weitere Besonderheit hatte der Fall dadurch, dass der Arbeitgeber irrtümlicherweise davon ausgegangenen ist, dass das Pokalfinale in Frankfurt am Main stattgefunden hätte. Tatsächlich hat es jedoch in Berlin stattgefunden. Außerdem berief sich der Arbeitnehmer darauf, dass er „nur“ zum Olympiastadion gegangen sei, sich jedoch ein Ticket für das Pokalfinale nicht hätte leisten können. Somit sprach viel dafür, dass die Kündigung zu Unrecht erfolgt ist. Andererseits war jedoch auch zu berücksichtigen, dass der Arbeitgeber vorsichtig ausgedrückt nicht gerade begeistert von dem Verhalten des Arbeitnehmers, insbesondere der Veröffentlichung der Fotos in den sozialen Medien trotz Arbeitsunfähigkeit war. Letztendlich hat mich sich einvernehmlich auf die Zahlung einer Abfindung, die Beendigung des Arbeitsverhältnisses und die Erteilung eines qualifizierten Zeugnisses verständigt und den Rechtsstreit hierdurch beendet.
Fazit
Der auf den ersten Blick verhältnismäßig einfache Fall zeigt anschaulich, dass es im Arbeitsrecht regelmäßig auf die Umstände des konkreten Einzelfalls ankommt. Welches Verhalten bei einer Krankheit gesundheitsförderlich ist und welches nicht, kann der behandelnde Arzt mitteilen. Die Verwendung von sozialen Medien kann schnell arbeitsrechtliche Konsequenzen auslösen. Insbesondere im Falle der Arbeitsunfähigkeit sollte mit sozialen Medien sehr sparsam umgegangen werden. Sollte es zu Problemen im Arbeitsrechtsverhältnis kommen bietet es sich an, sich sowohl als Arbeitgeber, als auch als Arbeitnehmer von einem spezialisierten Rechtsanwalt beraten und erforderlichenfalls vertreten zu lassen.