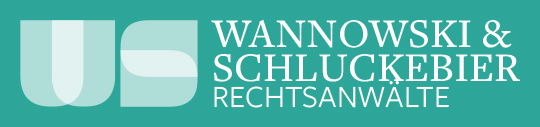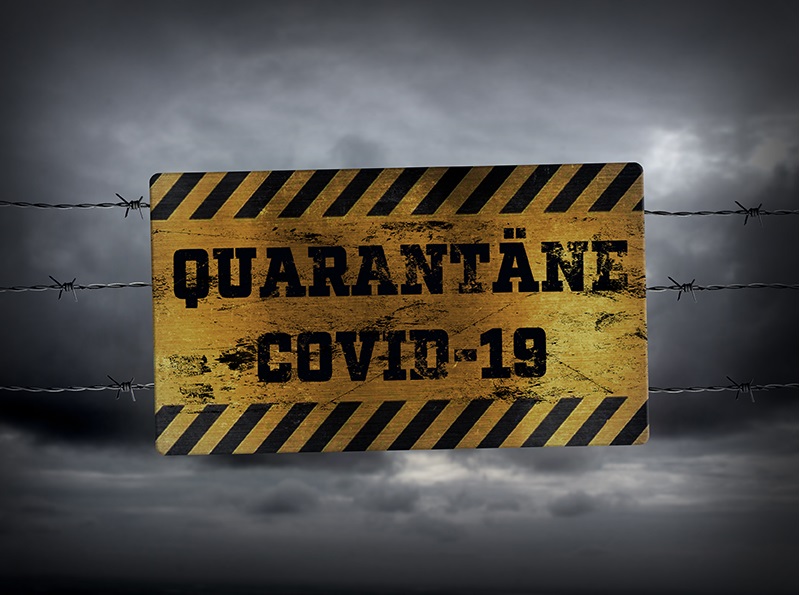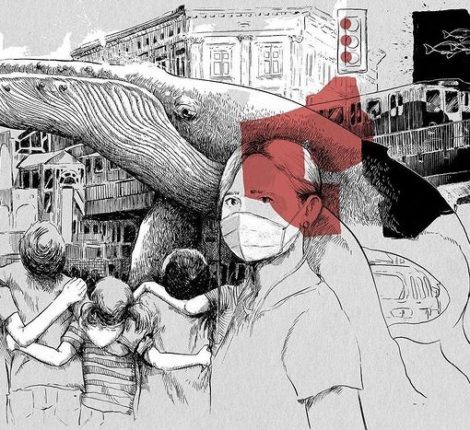Einzelhändlerin unterliegt vor dem Hamburgischen Oberverwaltungsgericht. Sie darf ihr Einzelhandelsgeschäft derzeit nur mit einer maximalen Verkaufsfläche von 800 m2 betreiben
Über das Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht Hamburg haben wir hier berichtet. Der 5. Senat des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichtes bleibt dabei, dass die Antragstellerin ihr Einzelhandelsgeschäft gegenwärtig nur mit einer maximalen Verkaufsfläche von 800 m2 betreiben darf. Der Antrag der Antragstellerin wurde mit Beschluss vom 30. April 2020 – 5 Bs 64/20 – abgelehnt und der Beschluss des Verwaltungsgerichts vom 21. April 2020 – 3 E 1675/20 – geändert.
Was war passiert?
Eine Einzelhändlerin wollte ihr Geschäft trotz eines entsprechenden Verbotes in der Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung vollständig öffnen und zog deshalb vor das Verwaltungsgerichts Hamburg. Sie gewann im Eilrechtsschutz in der ersten Instanz. Nur kurze Zeit hiernach wurde jedoch eine Zwischenverfügung vom Oberverwaltungsgericht Hamburg erlassen. Nunmehr hat das Oberverwaltungsgericht abschließend über die Beschwerde zu Gunsten der Freien und Hansestadt Hamburg entschieden.
Wesentliche Argumentation der Antragsgegnerin in der 2. Instanz
Die Freie und Hansestadt Hamburg rügte unter anderem, dass der Entscheidungsspielraum des Verordnungsgebers vom Verwaltungsgericht verkannt worden sei. Die Begrenzung der Verkaufsfläche auf maximal 800 m2 sei für die Erreichung der mit der Verordnung angestrebten Ziele geeignet.
Weitere Argumentation der Antragstellerin in der 2. Instanz
Die Einzelhändlerin berief sich unter anderem darauf, dass die Grenzmarke von 800 m2 willkürlich und vollkommen untauglich sei. Aus infektionshygienischen Gründen bestehe hierfür kein Erfordernis. Die Größe der Verkaufsfläche sei kein tauglicher Maßstab für eine Entscheidung über die Öffnung des Einzelhandels, was sie mit einer gutachterlichen Kurzstellungnahme belegen könne. Die Schließung von Betrieben wie dem ihrigen führe sogar zur Erhöhung der Infektionswahrscheinlichkeit. Die Schließung führe zur Verknappung von Bezugsquellen, da sich die gleichbleibende Kundenzahl auf weniger Verkaufsfläche verteilen müsste. Ihr drohten weiterhin schwere irreversible Nachteile.
Wesentliche Entscheidungsgründe des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichtes
Zunächst hielt das Hamburgische Oberverwaltungsgericht kurz fest, dass ein Anordnungsgrund zweifelsfrei gegeben ist. Allerdings fehle es an einem Anordnungsanspruch. Die Antragstellerin hätte keinen Anspruch auf die begehrte einstweilige Anordnung.
Verbot der Vorwegnahme der Hauptsache
Das Begehren der Antragstellerin stelle sich angesichts der befristeten Geltung der Eindämmungsverordnung als eine endgültige Vorwegnahme der Hauptsache dar. Anders als das Verwaltungsgericht es entschieden hatte, bejahte das Hamburgische Oberverwaltungsgericht eine unzulässige Vorwegnahme der Hauptsache. Die für die vor dem Hintergrund der Gewährung effektiven Rechtsschutzes nach Art. 19 Abs. 4 GG von der Rechtsprechung gewährte Ausnahme von dem Verbot der Vorwegnahme der Hauptsache sah es als nicht gegeben an. Die hierfür erforderliche weit überwiegende Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs in der Hauptsache bestehe nicht. Die entsprechende Regelung in der Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung erweise sich nach der im Eilverfahren gebotenen jedoch auch ausreichenden summarischen Prüfung als rechtmäßig.
gesetzliche Grundlage
Die Hamburgische SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung fände in §§ 32 Satz 1 & 2, 28 Absatz 1 Satz 1 IfSG eine hinreichende gesetzliche Grundlage
tatbestandliche Voraussetzungen
Die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 28 Absatz 1 Satz 1 IfSG sein aufgrund der gegenwärtig bestehenden Corona-Pandemie erfüllt. Insbesondere stelle die in der Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung geregelte Verkaufsflächenbeschränkung eine notwendige Schutzmaßnahme im Sinne von § 28 Absatz 1 Satz 1 IfSG dar. Die Regelung sei geeignet, erforderlich und geboten. Eine Verletzung der (Grund-)Rechte der Antragstellerin aus Art. 3 Absatz 1, Art. 12 Absatz 1 und Art. 14 GG läge nicht vor.
legitimer Zweck
Das Ziel der Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung sei die Bevölkerung weiterhin vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen und die Funktionsfähigkeit des Hamburgischen Gesundheitssystems zu sichern. Das Oberverwaltungsgericht hielt fest, dass bei der Beurteilung komplexer Gefahrenlagen, wie bei der aktuellen Corona-Pandemie, dem Verordnungsgeber ein weiter Entscheidungsspielraum hinsichtlich der Einschätzung der geeigneten, erforderlichen und gebotenen Maßnahmen zustehe. Die Hamburgische SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung verfolge somit einen legitimen Zweck.
Geeignetheit
Die Begrenzung der Verkaufsfläche in Einzelhandelsgeschäften auf maximal 800 m2 sei geeignet, die von der Antragsgegnerin verfolgten Ziele zu erreichen bzw. zu fördern. Dies hatte das Verwaltungsgericht Hamburg verneint.
Das Oberverwaltungsgericht kam zu dem Ergebnis, dass die Beschränkung maßgeblich zu einem Schutz der Gesundheit der Bevölkerung sowie der Sicherung des Hamburgischen Gesundheitssystems beitragen würde. Es hielt die Ausführungen der Freien und Hansestadt Hamburg hierzu – anders als das Verwaltungsgericht – für nachvollziehbar und stichhaltig. Insbesondere sei zu berücksichtigen, dass bei vollständiger Freigabe der gesamten Verkaufsfläche(n) der Kontrollaufwand für die Freie und Hansestadt Hamburg erheblich erhöht sei. Hamburgweit wären weitere Zehntausende Quadratmeter Verkaufsfläche für den Publikumsverkehr geöffnet. Es sei offensichtlich, dass die Kontrolle dieser insgesamt erheblich größeren Verkaufsfläche für die ohnehin stark beanspruchten Ordnungskräfte der Antragsgegnerin schwerer zu bewerkstelligen wäre. Außerdem sei die Kontrolle kleinerer Ladengeschäfte generell einfacher als die Kontrolle großflächiger Einzelhandelsgeschäfte, weil diese besser und schneller überblickt werden könnten.
Die Antragsgegnerin dürfe auch davon ausgehen, dass die Beschränkung(en) dazu beitragen würde(n), dass ein hoher Publikumsverkehr in den Einzelhandelsgeschäften und im öffentlichen Nahverkehr verhindert würde. Anders als das Verwaltungsgericht kam das Oberverwaltungsgericht zu dem Ergebnis, dass von großflächigen Einzelhandelsgeschäften wohl eine große Anziehungskraft auf die Bevölkerung ausgehen würde.
Außerdem würde die Öffnung von weiteren großflächigen Einzelhandelsgeschäften, die bisher noch geschlossen sein, dazu führen, dass zusätzliche Besucherströme nicht nur aus Hamburg, sondern auch aus den benachbarten Bundesländern angezogen werden würden. Hierbei verwies das Hamburgische Oberverwaltungsgericht auch darauf, dass Bürger aus Schleswig-Holstein ohne besonderen Grund nach Hamburg fahren dürfen, während umgekehrt Hamburgern die „Einreise“ nach Schleswig-Holstein nach wie vor weitgehend untersagt ist.
Dieses erhöhte Besucheraufkommen würde das Infektionsrisiko sowohl in den Einzelhandelsgeschäften, als auch im öffentlichen Nahverkehr erhöhen und die Gefahr verstärken, dass Ansteckungswege im Nachhinein nicht mehr nachvollzogen werden könnten.
Je mehr Personen sich in einem Einzelhandelsgeschäft aufhalten (könnten), desto mehr könnten potentiell mit dem Coronavirus Infizierten in Kontakt kommen.
Schließlich sein auch die Erfahrungen aus den ersten Tagen nach dem Inkrafttreten der neuen Regelung der Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung zu berücksichtigen. Diese zeigten, dass die von der Freien und Hansestadt Hamburg gewünschten Wirkungen eintreten sein. Obwohl in der Stadt und im öffentlichen Nahverkehr zwar wieder mehr Menschen unterwegs und die Geschäfte belebter sein, würden sich die Hamburger gleichwohl noch vorsichtig und zurückhaltend verhalten. Somit sei das Personenaufkommen in den Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr noch überschaubar.
Erforderlichkeit
Anders als das Verwaltungsgericht kam das Oberverwaltungsgericht zu dem Ergebnis, dass die Beschränkung der Verkaufsfläche auch erforderlich sei. Aus Infektionsschutzgründen sei nachvollziehbar, dass noch nicht alle Einzelhandelsgeschäfte wieder vollständig öffnen dürften.
mildestes Mittel
Im Gegensatz zum Verwaltungsgericht hielt das Oberverwaltungsgericht fest, dass kein milderes Mittel ersichtlich sei. Das Oberverwaltungsgericht hielt mehrfach in dem Beschluss fest, dass dem Verordnungsgeber ein weiter Entscheidungsspielraum hinsichtlich der Einschätzung der geeigneten, erforderlichen und gebotenen Maßnahmen zustehe. Dies führe unter anderem dazu, dass im derzeitgen Prozess erster Lockerungen nach einer Phase sehr strenger Schutzmaßnahmen es nachvollziehbar sei, dass der Verordnungsgeber nur in kleinen Schritten vorgehen wolle und insbesondere für den Einzelhandel nur eine teilweise Öffnung vorsähe, um die erreichten Erfolge nicht zu verspielen.
Eine Beschränkung der Zulassung auf Einzelhandelsgeschäfte nach der Attraktivität des Warenangebotes sei nicht praktikabel.
Die vom Verwaltungsgericht thematisierte Mund-Nasen-Bedeckungspflicht im öffentlichen Raum stellte nach Ansicht des Oberverwaltungsgericht kein milderes gleichermaßen geeignetes Mittel dar. Es erschiene fragwürdig, einen so weitreichenden empfindlichen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht sämtlicher Bürger und Besucher Hamburgs vorzunehmen, um weitere Öffnungen im großflächigen Einzelhandel zu ermöglichen.
Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne – Angemessenheit
Im Rahmen der Prüfung der Verhältnismäßig im engeren Sinn respektive Angemessenheit ist abzuwägen, ob die mit der Maßnahme verbundenen Nachteile nicht völlig außer Verhältnis zu den Vorteilen stehen, die sie bewirken soll. Hierbei sind hauptsächlich verfassungsrechtliche Vorgaben, insbesondere Grundrechte zu berücksichtigen.
Das Hamburgische Oberverwaltungsgericht hielt fest, dass die getroffene Maßnahme auch verhältnismäßig im engeren Sinn sein.
Hierzu führte der 5. Senat aus, dass ihm durchaus bewusst sei, dass selbst die derzeitige Regelung eine erhebliche Einschränkung der unternehmerischen Freiheit der Einzelhändlerin bedeute und möglicherweise gravierende Auswirkungen auf den Fortbestand ihres Unternehmens hätte. Somit stelle die Regelung einen erheblichen Eingriff in Grundrechte der Einzelhändlerin jedenfalls aus Art. 12 Absatz 1 GG und möglicherweise auch aus Art. 14 GG dar.
Diese Eingriffe müsse die Einzelhändlerin gleichwohl als notwendige Schutzmaßnahmen hinnehmen, da sie derzeit noch zur Verhinderung der Verbreitung der Corona-Pandemie erforderlich sein.
Hierbei sei auch zu berücksichtigen, dass die Freie und Hansestadt Hamburg mit der Verordnung ein Gesamtkonzept zur Bewältigung der Corona-Krise entwickelt habe, welches neben dem Hamburger Einzelhandel auch andere Wirtschafts- und Lebensbereiche beachten würde. Außerdem dürfe die Freie und Hansestadt Hamburg auch beachten, dass eine zu weitgehende Öffnung des Einzelhandels wieder zu einer deutlichen Zunahme des Infektionsrisikos und der Fallzahlen führen könnte, die gegebenenfalls längere oder weitere Einschränkungen in den genannten und anderen Bereichen zur Folge hätte. Insoweit trage die aktuelle Regelung auch dazu bei, den gesellschaftlichen Frieden in Hamburg zu wahren und sicherzustellen, dass die Bürger die ihnen auferlegten Einschränkungen (weiterhin) akzeptieren würden.
Gleichheitsgebot
Anders als das Verwaltungsgericht Hamburg nahm das Oberverwaltungsgericht keinen Verstoß gegen das Gleichheitsgebot des Art. 3 GG an. Eine Ungleichbehandlung zwischen dem großflächigen und dem sonstigen Einzelhandel bestehe nicht, weil die Regelung alle Einzelhandelsgeschäfte gleichbehandele.
Auch die Privilegierung von Kfz-, Fahrrad- und Buchhandlungen, welche mit Wirkung zum 20. April 2020 unabhängig von der Größe der Verkaufsfläche für den Publikumsverkehr geöffnet sein dürfen, sei nicht zu beanstanden. In Bezug auf den allgemeinen Gleichheitssatz könnten sich je nach Regelungsgegenstand und Differenzierungsmerkmalen unterschiedliche Grenzen für den Hoheitsträger ergeben. Für Rechtsbereiche der Gefahrenabwehr bestehe ein weiter Entscheidungsspielraum des Verordnungsgebers. Außerdem sei der Versorgungsauftrag von Buchhandlungen aufgrund der Informations-, Presse- und Wissenschaftsfreiheit sowie der Deckung des schulischen Bedarfs besonders bedeutsam. Der Kfz- und Fahrradhandel sei zur Sicherung der Mobilität der Bevölkerung der Grundversorgung zuzurechnen. Im Ergebnis sein die Ausnahmen somit nicht zu beanstanden.
Verfahrenskosten
Schließlich beschloss das Verwaltungsgericht Hamburg, dass die Kosten des gesamten Verfahrens die Antragstellerin zu tragen hat, § 154 Absatz 2 VwGO.
Fazit
Es bleibt spannend, wie sich die Rechtsprechung entwickeln wird. Trotz dieser für die Einzelhändlerin negativen Entscheidung, gibt es derzeit insbesondere vom Bundesverfassungsgericht eine Reihe grundrechtsfreundlicher Entscheidungen. Sollten Sie davon ausgehen, dass staatliche Maßnahmen Ihre Grundrechte missachten, ist es vorteilhaft, sich von einem erfahrenen Anwalt beraten und erforderlichenfalls vertreten zu lassen.