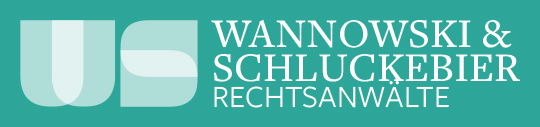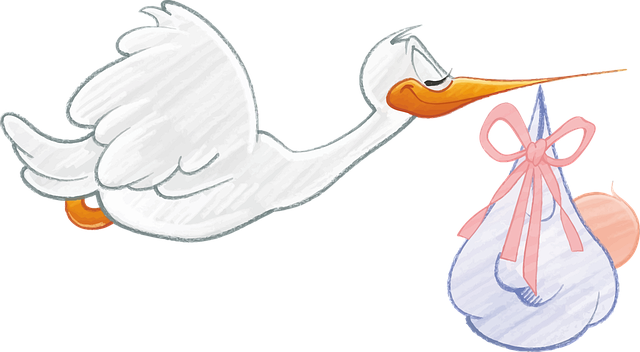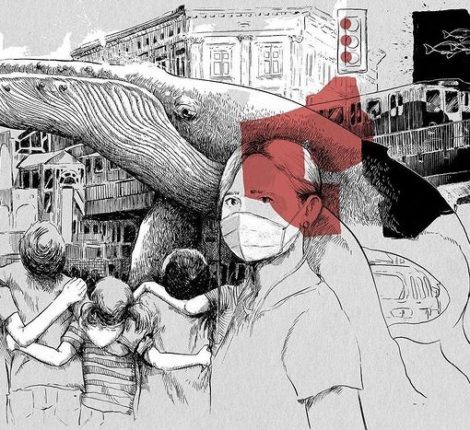Bundesarbeitsgericht stärkt die Rechte schwangerer Arbeitnehmerinnen
Der Zweite Senat des Bundesarbeitsgerichts entschied mit seinem Urteil vom 27.02.2020, Az.: 2 AZR 498/19, dass das Kündigungsverbot gegenüber einer schwangeren Arbeitnehmerin auch schon für eine Kündigung vor der vereinbarten Tätigkeitsaufnahme gilt.
Was war passiert?
Die Parteien stritten über die Wirksamkeit einer ordentlichen Kündigung.
Der Arbeitgeber, der in der Regel nicht mehr als zehn Arbeitnehmer beschäftigte, schloss mit der Klägerin am 9./14. Dezember 2017 einen Arbeitsvertrag über eine Tätigkeit als Rechtsanwaltsfachangestellte. Das Arbeitsverhältnis sollte Anfang Februar 2018 beginnen.
Die Arbeitnehmerin informierte den Arbeitgeber mit Schreiben vom 18. Januar 2018 darüber, dass bei ihr eine Schwangerschaft festgestellt und ihr aufgrund einer chronischen Vorerkrankung „mit sofortiger Wirkung ein komplettes Beschäftigungsverbot“ attestiert worden war.
Mit Schreiben vom 30. Januar 2018 kündigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis zum 14. Februar 2018.
Dagegen hat die Arbeitnehmerin fristgemäß (Kündigungsschutz-)Klage eingereicht.
Wesentliche Argumentation der Arbeitnehmerin
Aufgrund des Kündigungsverbots des § 17 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Mutterschutzgesetz (kurz: MuSchG) sei die Kündigung unwirksam.
Wesentliche Argumentation des Arbeitgebers
Das Kündigungsverbot des MuSchG finde auf arbeitgeberseitige Kündigungen vor der vereinbarten Tätigkeitsaufnahme keine Anwendung. Ein anderes Verständnis führe zu einem unzulässigen Eingriff in die durch Art. 12 Absatz 1 GG geschützte Berufsausübungsfreiheit des Arbeitgebers.
Prozessverlauf
Das Arbeitsgericht Kassel – Urteil vom 3. Mai 2018 – 3 Ca 46/18 – und das Hessisches Landesarbeitsgericht – Urteil vom 13. Juni 2019 – 5 Sa 751/18 – haben zugunsten der Schwangeren entschieden und festgehalten, dass das Kündigungsverbots des § 17 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 MuSchG auch bei einer Kündigung vor Dienstantritt gilt.
Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts
Dem ist der Zweite Senat des Bundesarbeitsgerichts mit seinem Urteil vom 27.02.2020, Az.: 2 AZR 498/19 gefolgt.
§ 17 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 MuSchG statuiert, dass die Kündigung gegenüber einer Frau während ihrer Schwangerschaft unzulässig ist, wenn dem Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Kündigung die Schwangerschaft bekannt oder sie ihm innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Kündigung mitgeteilt worden ist.
§ 17 Absatz 1 MuSchG stellt ein gesetzliches Verbotsgesetz im Sinn des § 134 BGB dar. Eine Kündigung unter Verstoß gegen dieses Verbot ist somit nach § 134 BGB nichtig.
Frage des Falls
Fraglich war im entschieden Fall, ob der Arbeitnehmerin ein sogenannter besonderer Kündigungsschutz in Form des Kündigungsverbots des § 17 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 MuSchG zustand; das Kündigungsverbot also auch bei einer Kündigung vor Dienstantritt gilt.
Weil der Arbeitgeber, in der Regel nicht mehr als zehn Arbeitnehmer beschäftigte und das Arbeitsverhältnis nicht länger als sechs Monate bestanden hatte, stand der Arbeitnehmerin kein allgemeiner Kündigungsschutz zu.
Kündigungsschutz
Arbeitnehmern kann allgemeiner und/oder besonderer Kündigungsschutz zustehen.
Allgemeiner Kündigungsschutz
Für den allgemeinen Kündigungsschutz sind die Betriebsgröße und die Betriebszugehörigkeit entscheidend. Im Betrieb müssen somit gemäß § 23 Absatz 1 Satz 3 Kündigungsschutzgesetz (kurz: KSchG) in der Regel mehr als zehn Arbeitnehmer beschäftigt sein. Außerdem muss gemäß § 1 KSchG das Arbeitsverhältnis in demselben Betrieb oder Unternehmen ohne Unterbrechung länger als sechs Monate bestanden haben.
Sonderkündigungsschutz
Besonderer Kündigungsschutz besteht regelmäßig aufgrund von persönlichen Umständen des Arbeitnehmers.
Auslegung
Der Gesetzeswortlaut des § 17 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 MuSchG trifft keine Aussage darüber, ob der Kündigungsschutz auch schon für eine Kündigung vor der vereinbarten Tätigkeitsaufnahme gilt. Deshalb hatten die Gerichte durch Auslegung zu bestimmen, ob das Kündigungsverbots auch im Falle einer Kündigung vor Dienstantritt gilt.
Es war ausreichend, dass ein sogenanntes Beschäftigungsverhältnis bestand. Ein Beschäftigungsverhältnis entsteht mit Abschluss des Arbeitsvertrags. Dies gilt auch dann, wenn die Tätigkeit erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen werden soll, weil schon mit dem Vertragsabschluss wechselseitige Verpflichtungen begründet werden.
Das Bundesarbeitsgericht führte aus, dass schon die Gesetzessystematik es nahelege, dass das Kündigungsverbots auch im Falle einer Kündigung vor Dienstantritt gilt.
Jedenfalls der Normzweck des Kündigungsverbots spreche dafür, dass die Aufnahme der vereinbarten Tätigkeit nicht für dessen Eingreifen erforderlich sei.
Das Bundesarbeitsgericht hielt fest, dass das Kündigungsverbot die (werdenden) Mütter einen Gesundheits- und Existenzsicherungsschutz gewährleisten soll. Für diese Auslegung sprächen auch die in § 1 Absatz 1 MuSchG generell formulierten Zwecke des Mutterschutzgesetzes sowie die Entstehungsgeschichte des § 1 Absatz 2 Satz 1 MuSchG.
Die erfolgte Auslegung des Kündigungsverbots stehe auch im Einklang mit dem Unionsrecht und der Rechtsprechung des Gerichtshof der Europäischen Union (Urteil vom 11. November 2010 – C-232/09 – Danosa).
Schließlich beständen bei der Auslegung des Kündigungsverbots auch keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Jedenfalls wäre ein Eingriff in den Schutzbereich durch den verfolgten Zweck gerechtfertigt. Somit war der Arbeitgeber auch mit seiner Argumentation, wonach die Anwendung des Kündigungsverbots zu einem unzulässigen Eingriff in die durchArt. 12 Absatz 1 GG geschützte Berufsausübungsfreiheit führen würde nicht erfolgreich.
Zusammenfassend war die Kündigung des Arbeitgebers aufgrund von § 17 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 MuSchG in Verbindung mit § 134 BGB nichtig.
Fazit
Das Bundesarbeitsgericht hat mit seiner Entscheidung die Rechte schwangerer Arbeitnehmerinnen gestärkt. Vielen Arbeitnehmern ist nicht bekannt, ob ihnen ein Sonderkündigungsschutz zusteht. Im Falle einer Kündigung ist Arbeitnehmern regelmäßig zu raten sich zeitnah von einem erfahrenen Anwalt beraten und erforderlichenfalls vertreten zu lassen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der kurzen Klagefrist von 3 Wochen des § 4 Satz 1 Kündigungsschutzgesetz (kurz: KSchG). Diese Frist beginnt mit dem Zugang der schriftlichen Kündigung. Sie gilt für alle vom Arbeitgeber ausgesprochenen Kündigungen, unabhängig von der Art des Unwirksamkeitsgrunds und davon, ob das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet oder nicht.