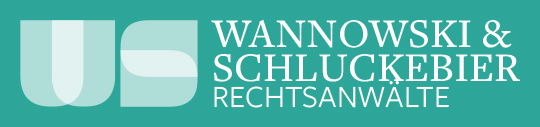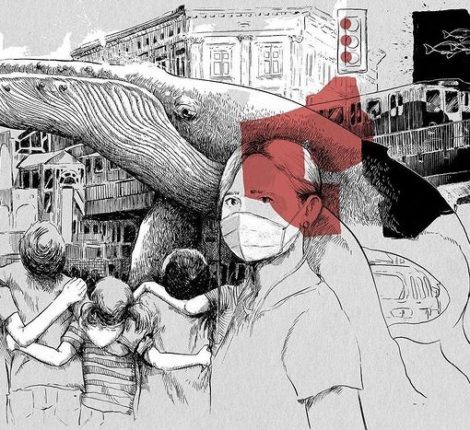Freie Fahrt für Freie Bürger ./. Blackbox Blitzer
Nach dem Formfehler in der letzte Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) steht die nächste Entscheidung im Zusammenhang mit der Geschwindigkeitskontrolle im Straßenverkehr an. Über den Blitzer TraffiStar S 350 berichten wir mit drei Entscheidungen
dem Urteil des VerfGH Saarland, 05.07.2019 – Lv 7/17,
dem Beschluss des OLG Brandenburg vom 02.01.2020 – (1 Z) 53 Ss-OWi 719/19 (406/19) und
der Verfügung des AG Meißen vom 14.05.2020 – 13 OWi 930 Js 31650/19
Im Juli wurde bekannt, dass die letzte Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) und die damit verbundene Verschärfung der Sanktionen (Bußgeld, Fahrverbot etc.) für Verkehrssünder aufgrund eines Formfehlers ungültig sind. Der rechtliche Verstoß betraf das sogenannte Zitiergebot aus Artikel 80 Absatz 1 Satz 3 des Grundgesetzes. Alle Sanktionsverschärfungen für die Zeit von April an wurden zurückgenommen.
Nun steht die nächste das Ressort des Verkehrsministerium betreffende Entscheidung an. Es geht um eine bundeseinheitliche Rechtsprechung zum Thema automatisierte Geschwindigkeitskontrolle im Straßenverkehr. Einer dieser Blitzerautomaten mit der Bezeichnung TraffiStar S 350 steht im besonderen Fokus der justiziellen Aufmerksamkeit.
Der von Jenoptik Robot hergestellte TraffiStar S 350 ist in ganz Deutschland (außer im Saarland, dazu gleich) verbreitet im Einsatz. Bei diesen Blitzern kommen modernste Laser- und Radartechnologie zum Einsatz. Zahlreiche Sensoren und hochauflösende Kameras machen das Messsystem zu einem hoch technisierten und mittlerweile auch voll digitalisierten Alleskönner – so heißt es zumindest in den Herstellerangaben. Richtig aufgestellt erledigen sich die Arbeit der Geschwindigkeitskontrolle von alleine. Die vorbeifahrenden Fahrzeuge werden erfasst, deren Geschwindigkeit gemessen und bei Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit wird ein Foto erstellt.
Nach dem Werbetext der Jenoptik Robot dokumentiert der Blitzer Verkehrsverstöße automatisch. Weiter heißt es, die Geräte funktionieren ohne Personalaufwand und sind besonders robust.
Hier kommen wir allerdings zu dem Problem, dass Verkehrsverstöße bisher grundsätzlich von der Behörde (Polizei/Ordnungsamt) oder bei Einspruch durch den Geblitzten von einem Gericht festgestellt werden. Daher stellt sich die Frage, ob auch eine Maschine so geschaffen und eingesetzt werden kann, dass sie als Ergebnis nicht nur die Geschwindigkeitsmessung, sondern letztlich den Gesetzesbruch feststellt.
Zahlreiche Sachverständige, einige Amtsgerichte und der Verfassungsgerichtshof des Saarlandes meinen nun aber, dass eine Nachprüfung der Geschwindigkeitsmessung beim Einsatz dieser Technologie nicht stattfinden kann. Das Gerät präsentiere lediglich das Ergebnis. Dies hieße im Umkehrschluss, dass angenommen werden muss, dass die eingesetzte Technologie immer fehlerfrei funktioniert oder selbstständig erkennt, dass sie nicht fehlerfrei funktioniert, dies anzeigt und die Tätigkeit von alleine einstellt.
Der Verfassungsgerichtshof des Saarlandes
sieht den geblitzten Beschwerdeführer in seinen Grundrechten auf ein faires Verfahren nach Artikel 60 Absatz 1 i.V.m. Arikel 20 Verfassung des Saarlandes (SVerf) und in seinem Grundrecht auf eine wirksame Verteidigung aus Artikel 14 Absatz 3 SVerf verletzt (Anmerkung: Die vom Gerichtshof zitierten saarländischen Normen können in Ihrem Regelungsgehalt mit denen aus anderen Bundesländern, denen des Bundes u.a. Artikel 20 Abs. 3 GG und denen des Artikel 6 Absatz 1 Europäischen Menschenrechtskonvention sowie des Artikel 47 Absatz 2 Europäischen Grundrechts-Charta verglichen werden).
Der Verfassungsgerichtshof hält das Recht des Einzelnen sich gegen eine staatliche Sanktionierung zu wehren und dabei nicht von vorn herein chancenlose zu sein auch in Bußgeldverfahren über Geschwindigkeitsüberschreitung für wirksam. Zur Begründung der Rechtsverletzung bemängelt der Gerichtshof, dass die Rohmessdaten der Geschwindigkeitsmessung zur nachträglichen Plausibilitätskontrolle nicht zur Verfügung stehen.
Da Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes nur im Saarland gelten, kam es außerhalb des Saarlandes zu anderen und gegenteiligen Entscheidungen (hier: finden Sie eine nicht ganz korrekte Auflistung der bisherigen obergerichtlichen Entscheidungen).
Zur anderen Ansicht hat sich auch das
Oberlandesgericht Brandenburg (OLG)
positioniert. Das Gericht stellt, etwas vereinfacht dargestellt, fest, dass es sich lediglich um eine geringfügige Sache mit der Anordnung von nur einer geringen Geldbuße von nicht mehr als 100,00 € handelt.
Solche Urteile können nur mit der Rechtsbeschwerde und nicht mit der Berufung angefochten werden. Die Rechtsbeschwerde sei nach § 80 Absatz 1 Absatz 2 Nummer 1 OWiG (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten) aber nur zulässig, wenn es geboten sei, die Nachprüfung des angefochtenen Urteils zur Fortbildung des materiellen Rechts zu ermöglichen oder das Urteil wegen Versagung des rechtlichen Gehörs aufzuheben. Ein solcher Fall läge hier aufgrund der Geringfügigkeit nicht vor. Hierbei zählt für das Gericht nur der einzelne Fall. Keine Rolle spiele dabei die Tatsache, dass es von diesen geringfügigen einzelnen Fällen eine Vielzahl gibt, was in der Gesamtheit der Betroffenen einen beträchtlichen Umfang einnimmt.
Dies führt dazu, dass der Anspruch auf rechtliches Gehör nach § 80 Abs. 1 Nr. 2 OWiG lediglich sicherstellen soll, dass dem Betroffenen nicht Tatsachen vorenthalten werden, die dem Gericht bekannt sind. Da die vom Blitzer TraffiStar S 350 nicht gespeicherten und dokumentierten Rohmessdaten der Geschwindigkeitsmessung auch nicht dem Gericht vorlägen, wäre der Betroffene nicht in seinen übergeordneten Rechten verletzt. Nach seit Jahrzehnten ständiger Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesgerichtshofs soll der Anspruch auf rechtliches Gehör verhindern, dass das Gericht ihm bekannte, dem Beschuldigten aber verschlossene Sachverhalte zu dessen Nachteil verwertet (vgl. Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 12. Januar 1983; Bundesgerichtshof, Urteil vom 26. Mai 1981, 1 StR 48/81). Die Nichteinbeziehung von Beweismitteln oder Unterlagen berühre den Schutzbereich des rechtlichen Gehörs nicht. Folglich sieht sich das OLG Brandenburg nicht zur Entscheidung zu der aufgeworfenen Fragestellung berufen.
Ohne Einfluss auf die Entscheidung führt das OLG jedoch weiter aus, dass es die Auffassung des Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes, dass die fehlende Speicherung/Dokumentation der Rohmessdaten beim TraffiStar S 350 nicht zu einer Unverwertbarkeit der Geschwindigkeitsmessung führe, nicht teile. Womit wir zurück beim Thema wären.
Das Oberlandesgericht (OLG) führt in Randnummer 12 der Entscheidung aus, dass die vom Verfassungsgericht des Saarlandes festgestellten Rechtsverletzungen des Einzelnen hinter der Erhaltung der Funktionstüchtigkeit der Rechtspflege, welche ebenfalls Verfassungsrang habe, zurück treten müsse. Eine Ordnungswidrigkeit habe nur einen geringen Unrechtsgehalt und sei gerade mit keinem ethischen Vorwurf eines kriminellen Unrechts verbunden. Die Sanktionen einer Ordnungswidrigkeit seien lediglich eine nachdrückliche Pflichtenmahnung.
Die massenhafte Beschäftigung mit diesen „Bagatellsachen“ blockiere und Lähme die Gerichte. Die Funktionstüchtigkeit der Rechtspflege sei in Gefahr. Daher können im Bereich von Geschwindigkeitsmessungen im Straßenverkehr sogenannte standardisierte Messverfahren eingesetzt werden. Für diese Messverfahren können herabgesetzte Anforderungen an die Darlegung gelten. Dafür müssten die Geräte zuvor einer eingehenden Prüfung durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) unterzogen werden. Die vorweggenommene Prüfung des Blitzers böte in hohem Maße die Gewähr, dass es nur in einem Ausnahmefall zu einer Fehlmessung kommen kann. Das OLG nimmt also an, dass die Fehlerquote des Blitzers inklusive Software und Hardware marginal und die möglicher Weise vorkommenden Falschmessungen, gesehen auf die Gesamtzahl, belanglos seien.
Aber was macht dann eigentlich noch ein Gericht, das nach einem Einspruch des Geblitzten sich der Sache annehmen soll? Das zumindest fragt sich das
Amtsgericht Meißen
in einer 23 Seiten umfassenden Verfügung vom 14.05.2020 – 13 OWi 930 Js 31650/19.
Wenn das Ergebnis der Beweisaufnahme schon vorher feststeht, wird das Gerichtsverfahren zu einer inszenierten Theatervorstellung. In der Konsequenz könnte eigentlich das Recht des Einzelnen, gegen Ordnungswidrigkeiten im Bereich Geschwindigkeitskontrolle durch Einspruch und gerichtliche Überprüfung vorzugehen, entfallen. Die Feststellung des Verkehrsverstoßes erfolgt dann vollautomatisiert durch die Technik.
Das Amtsgericht Meißen stellt ausführlich begründet fest, dass eine Verteidigung gegen den Vorwurf aus einem standardisierten Messverfahren nach der derzeitigen Rechtssprechung der Obergerichte von vornherein unmöglich sei.
Das Gericht beruft sich auf seine langjährige Erfahrung und Befragung verschiedener Sachverständiger zu dieser Problematik und kommt zu dem Ergebnis, dass die Technik nicht immer fehlerfrei ist. Ohne Zugriff auf Rohmessdaten könne aber von vornherein keine Prüfung des konkreten Messvorgangs erfolgen.
Die automatisierte Feststellung des Gesetzesverstoßes durch das Hightechgerät schränke die freie Überzeugungsbildung des Tatrichters und dessen Verpflichtung zur Tatsachenerforschung von Amtswegen über die Maße ein. Das Zustandekommen des dem einzelnen Betroffenen vorgeworfenen Messwertes sei ein „großes Geheimnis“, so das AG Meißen weiter.
Das Amtsgericht geht dabei mit den obergerichtlichen Entscheidungen hart ins Gericht. Diese würden verlangen, ein Tatgericht habe den „unabhängigen Behörden“ der Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) und den Landesbehörden, welche die Blitzer testen und eichen, Glauben zu schenken, da diese Behörden der „Narretei fernstünden“.
Interessanter Weise führt das Gericht weiter aus, dass Jenoptik Robot direkt nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshof des Saarlandes eine Software entwickelt hat, die die Rohmessdaten speichere. Allerdings habe die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) den Einsatz der Software nicht zugelassen, da diese für Manipulierungen anfällig sei.
Das Amtgericht Meißen bemängelt eine „schier unglaubliche Technik- bzw. Technikergläubigkeit“ der Obergerichte. Dem vermag sich das Amtsgericht – aus schlichter Lebenserfahrung im Allgemeinen – nicht anzuschließen.
Bisher habe sich bei jedem komplexen Messgerät in der Praxis Geräte- und Softwarefehler feststellen lassen. Die Geräte werden immer komplexer. Sie müssen „mit geringstem Personalaufwand in jeder nur erdenklichen Lage, bei allen Temperatur-, Wind-, Licht- und Wetterbedingungen, bei allen Straßenverhältnissen, über alle Fahrspuren hinweg, von verschiedenen Aufstellungsorten, mobil und stationär, aus dem Fahrzeug, beliebig befestigt oder aufgebaut sowie einfach und schnell bedienbar und deren Messergebnisse nebst Fahrer- und Fahrzeugzuordnungen leicht auswertbar sein“.
Das Amtsgericht bezweifelt, dass es tatsächlich eine fehlerfreie Software gibt bzw. geben kann. Mit steigender Komplexität bei der Programmierung und der erforderlichen Beteiligung von mehreren Programmierern seien Fehler vorprogrammiert (SAP-Vorstand Claus Heinrich:
„Zu 100 Prozent fehlerfreie Software gibt es nicht“,
Quelle: https://www.computerwoche.de/a/zu-100-prozent-fehlerfreie-software-gibt-es-nicht,567618). Eine Software gelte als marktreif, nicht wenn sie fehlerfrei ist, sondern wenn sie robust ist. Das wiederum wird angenommen, wenn nur sehr selten auftretende Fehler keine größeren Schäden verursachen.
Darüber hinaus hält das Gericht auch konkret geringe Bußgelder für die Betroffenen nicht für eine Bagatelle, da häufig, nämlich ab einem Bußgeld von 60,00 €, ein Fahrverbot mit existenzbedrohlichen Auswirkungen und weiteren verwaltungsrechtlichen Sanktionen drohe.
Im Ergebnis sieht das Amtsgericht die Erforderlichkeit einer Begutachtung der Gerätesoftware des im Fall betroffenen Blitzers gegeben. Dieses müsste durch zwei unabhängige Sachverständige durchgeführt werden. Den Zeitbedarf schätzt das Gericht auf ein Jahr. Die Gutachterkosten lägen für eine Messung bei etwa 140.000,00 €.
Aus diesen und weiteren Gründen regt das Amtsgericht dringend die Einstellung gemäß § 47 Absatz 2 OWiG an. Damit rechtsstaatliche Anforderungen erfüllt werden, müsse es unabhängigen Gerichten möglich sein, die Zuverlässigkeit der Messgeräte zu kontrollieren.
Aussicht :
Entscheidungen auf Bundesebene durch den Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht stehen noch aus, sind aber noch in dieser Legislaturperiode zu erwarten.
Mit der Frage, ob automatisierte und Software gestützte Prozesse Menschen kontrollieren, zur Pflichterfüllung ermahnen und sogar sanktionieren können, werden wir uns weiter zu beschäftigen haben.
Sollten Sie einen Bußgeldbescheid erhalten haben und die dortigen Angaben anzweifeln, können wir Sie gerne aus unserer guten Erfahrung heraus anwaltlich beraten und erforderlichenfalls robust vertreten.